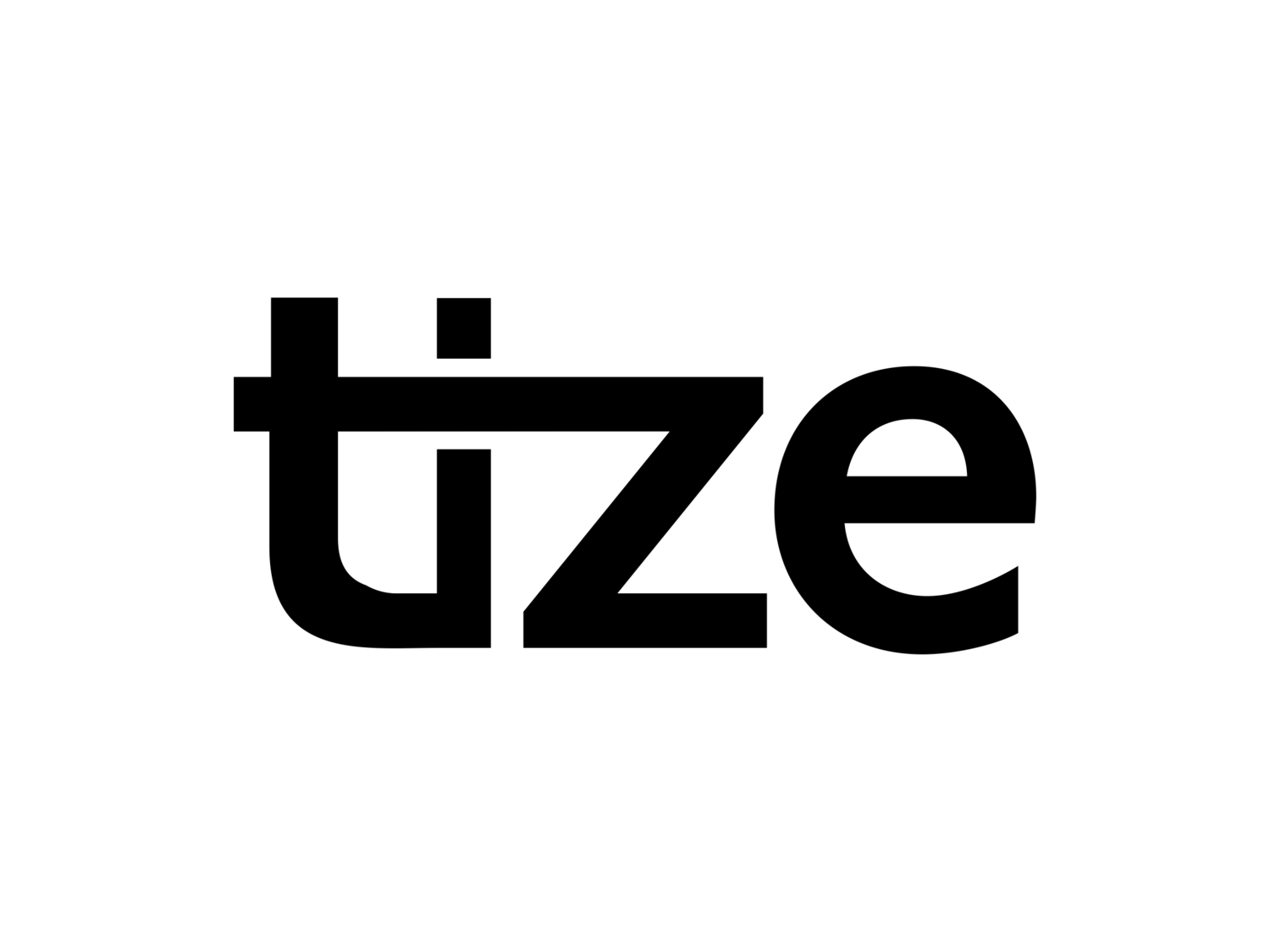Für einen fitten Lifestyle nutzen viele die Angebote ihrer lokalen Fitnessstudios. Doch ab wann kann die Hingabe für den Lebensstil im Gym auch schädlich sein?
Fitnessstudios erfreuen sich insbesondere seit den 80er Jahren an grosser Beliebtheit. Die Diversität an Geräten und Freiheit in der Routine spricht die Massen an. Während Knöchelwärmer und jährliche Abonnementmodelle inzwischen zeitgemässeren Angeboten gewichen sind, bleibt der Hype rund um Gyms berechtigterweise bestehen.
Viele können von der Disziplin, dem Gemeinschaftsgefühl und der Stärkung der Gesundheit profitieren, die man durch den Gang ins Fitnessstudio gewinnen kann. Hierbei ist die Linie zwischen Passion und Fanatismus allerdings feiner, als man denken könnte – obschon heutzutage ein grösseres Bewusstsein für mentale Gesundheit besteht.
«Gymbro» Kultur
Von Makros (Aufnahme an Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten) zählen über Proteinshakes bis hin zu Meal Prep: Der klassische «Gymbro» ist den meisten ein Begriff. Das Internet ist gespickt mit «Gymbro» Memes und das Thema ist vor allem bei Jüngeren sowie Sportbegeisterten präsent. Es gibt Social Media Kanäle, die sich einzig der «Gymbro» Kultur widmen und mit #GymTok ist eine ganz eigene Subkultur auf TikTok aufgekommen. Doch wieso ist der Lebensstil in den letzten Jahren immer mehr zur Zielscheibe von Spott und Kritik geworden?

Nicht nur aber vor allem junge Männer sind den negativen Seiten der sogenannten «Gymbro Kultur» ausgesetzt. Generell kann ein Hyperfokus auf Gewicht und Gesundheit schädliche Formen annehmen. Dies unabhängig von Geschlecht und Alter. Bei Männern herrscht jedoch ein grösseres Stigma bezüglich mentaler Krankheiten. Obschon die Wichtigkeit, offen über seine Gefühle zu sprechen bei den jüngeren Generationen durchweg angekommen ist, haben viele noch Mühe damit. Die Hemmschwelle, sich womöglich notwendige professionelle Hilfe zu holen ist dann noch etwas grösser.
Hyperfokus Körperbild
Schnell kann das Körperbild zur Sucht werden, wenn man sich täglich damit befasst. Die ständige Auseinandersetzung mit seiner Gesundheit und dem eigenen Körper kann im schlimmsten Fall zu einer Ess- oder körperdysmorphen Störung führen. Insbesondere das gegenseitige Pushen und Vergleichen innerhalb der Community kann eine Gratwanderung sein. Viele selbsternannte Alpha Male Influencer motivieren ihre Follower auch zu einem Schwarz-Weiss-Denken und lassen keinen Spielraum für Weichheit oder sogenannte «Off Days». Die Domäne ist teilweise dominiert von veralteten patriarchalen Denkweisen und überholten Einstellungen zu Körperbild und -gefühl. Es gibt sogar Berichte, in denen extreme Formen des «Gymbro» Mindsets zu Unfällen, Verletzten oder Toten führte.
Leidet man unter Körperdysmorphie hat man ein negatives Körperbild und ist davon überzeugt, dass der eigene Körper Fehler oder Makel aufweist. Dies führt zu wiederholten Handlungsweisen wie Vergleichen mit anderen, sogenanntes «Body Checking» (übermässiges sich im Spiegel inspizieren) oder übertriebenes Herrichten. In Wahrheit sind diese Fehler allerdings kaum oder gar nicht vorhanden. Die Diagnose erfolgt, wenn durch die Symtome Leidensdruck erfolgt oder Arbeits- respektive Privatleben beeinträchtigt sind. Da die körperdysmorphe Störung erst 2021 in die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD-11) aufgenommen wurde, gibt es diesbezüglich keine offiziellen Zahlen des Bundesamt für Statistik (BFS). Insgesamt leiden aber laut BFS 3.5 Prozent der Schweizer Wohnbevölkerung im Verlauf ihres Lebens mal an einer Essstörung.
Die Suizidrate in der Schweiz sinkt stetig, laut BFS seit Jahrzehnten. Von 2019 bis 2021 reduzierte sich die Rate bei Männern gar um 4.8 Prozent. Während 2008 Suizid bei den 25–44-jährigen Männern noch die Haupttodesursache war, waren es 2021 Unfälle und Gewalteinwirkungen. Dennoch wurden (Stand 2021) zwei Drittel der Suizide von Männern begangen. Ein Hinweis auf Handlungsbedarf?

Dass die Stigmatisierung mentaler Krankheiten – nicht nur bei Männern – zum Suizid führen kann, ist kein Geheimnis. Das Phänomen ist weltweit verbreitet und führt dazu, dass sich Betroffene nicht die Hilfe holen, die sie benötigen. Ob beispielsweise Anti-Stigma-Kampagnen signifikante Veränderung erwirken können, ist allerdings umstritten. Ein Beispiel wäre Time To Change. Das Projekt kostete Grossbritannien und Schottland 20,5 Millionen Pfund – doch die allgemeine Verbesserung (in den Parametern Wissen, Einstellungen und Verhalten) zwischen 2007 und 2011 betrug «nur» 2,4 Prozent.
Ungerechtfertigte Kritik?
Die «Gymbro» Kultur nur zu kritisieren oder als Hauptverursacher Ess- oder körperdysmorpher Störungen darzustellen wäre allerdings zu kurz gegriffen. Pflegt man einen ausgewogenen Lebensstil sowie einen bewussten Umgang mit Sportangeboten, ist die Gefahr für negative Folgen gering. Problem scheint vor allem die Stigmatisierung mentaler Krankheiten zu sein – insbesondere bei Männern.
Zudem gibt es weitere Ursachen für Sportverletzungen und mentale Krankheiten. Besonders die inflationäre Verwendung von Influencer:innen als Vorlage für die eigene Workout-Routine kann gefährlich sein. Es müssen stets Anpassungen an den eigenen Körper und Lebensstil vorgenommen werden. Denn führt man Übungen nicht korrekt aus oder überlastet sich, können dauerhafte Schäden entstehen.
Für viele Gym-Begeisterte überwiegen die positiven Seiten. Wichtig ist, sich zu informieren und die potenziellen Gefahren nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Mithilfe achtsamer Nutzung der Angebote und Priorisierung der mentalen Gesundheit kann man eigentlich nichts falsch machen. Und nicht zuletzt damit, sich Hilfe zu holen, wenn man sie braucht – sei es in Form eines Personal Trainers oder einer Fachperson für Psychologie.