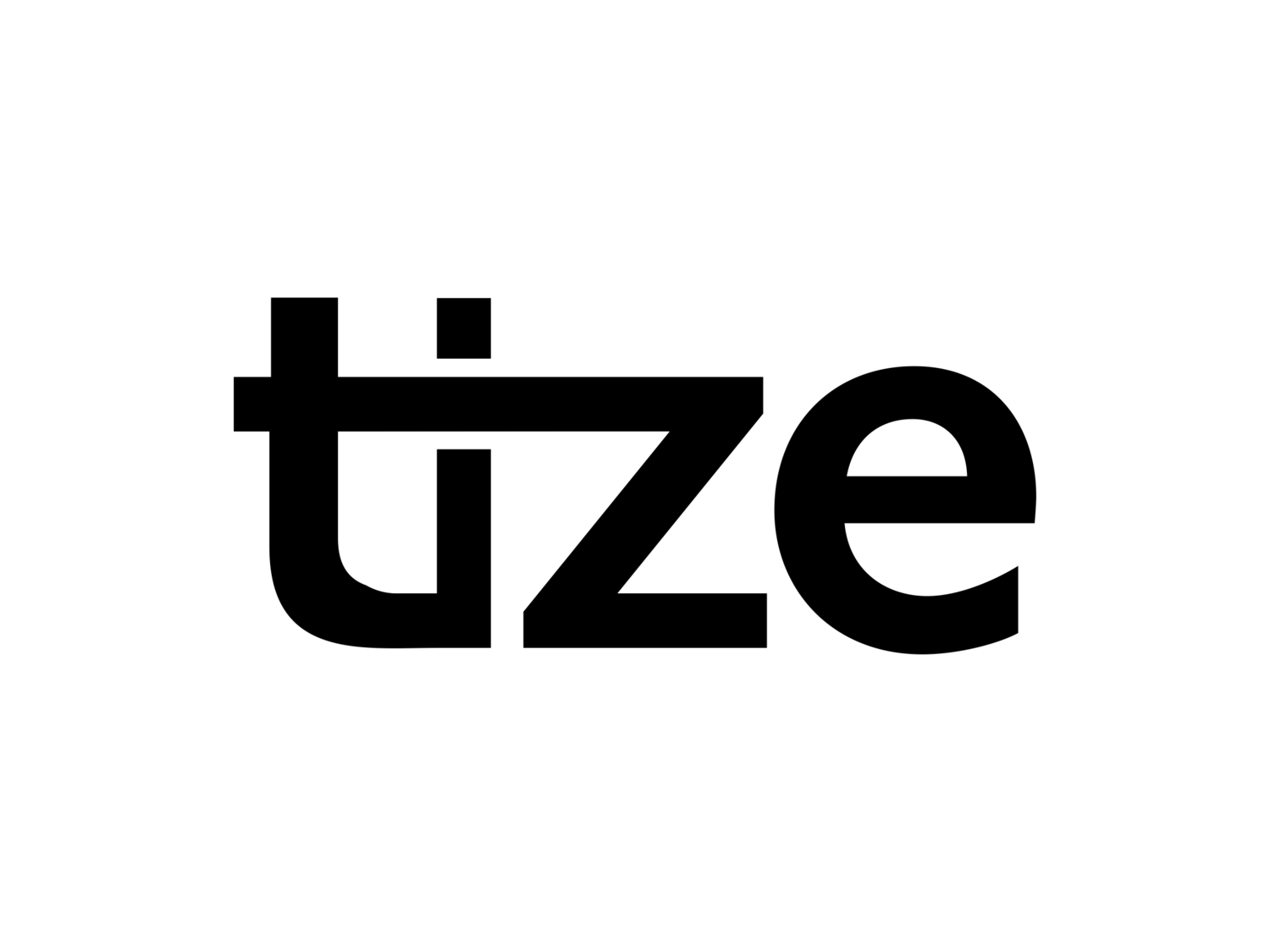Begriffe wie Datenschutz und digitale Privatsphäre haben in den letzten Jahren, insbesondere nach einigen grossen Skandalen, enorm an Wichtigkeit gewonnen. Dennoch scheint dieses Thema bislang fast nur Personen mit ohnehin vorhandenem Interesse an IT zu beschäftigen. Warum diese Themen jedoch für jeden einzelnen Menschen und die Gesellschaft als Ganzes wichtig sind, darum geht es in diesem ersten Teil der Artikelserie zu Datensicherheit.
Mitte 2014 veröffentlichte Glenn Greenwald im Namen von Edward Snowden in der amerikanischen Zeitschrift The Guardian die Nachricht über das enorme Ausmass der globalen Überwachung durch die NSA. Anfang 2018 klärte der ehemalige Cambridge-Analytica Mitarbeiter Christopher Wylie darüber auf, wie Facebook zusammen mit seiner früheren Firma massenhaft persönliche Daten ohne das Wissen der Nutzer sammelte. Um solche Skandale herum steigt das Interesse und Bedürfnis nach Schutz der eigenen Daten für eine gewisse Zeit, um dann aus Faulheit oder Gewohnheit wieder verloren zu gehen. Jedoch sind solche Skandale oftmals nur die Spitze eines Eisbergs, von welchem der grösste Teil unsichtbar bleibt.
Ist ja nicht so schlimm
Nicht selten hört man in Gesprächen die Meinung, dass dies ja nicht so schlimm sei. Im Gegenteil, selbst der langjährige CEO von Google, Eric Schmidt, äusserte sich auf diese Weise: «Wenn Sie etwas tun, von dem sie nicht möchten, dass dies andere wissen, dann sollten Sie es vielleicht von vornherein nicht tun.» Gerade auch in der Schweiz wird von bürgerlichen Parteien in Zusammenhang mit Überwachung und Datenspionage oft das Argument gebracht: «Wer nichts zu verstecken hat, hat auch nichts zu befürchten.»
Zu argumentieren, dass Sie keine Privatsphäre brauchen, weil Sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden Sie sagen, dass Sie keine Meinungsfreiheit brauchen, weil Sie nichts zu sagen haben.
Edward Snowden
Keine Privatsphäre zu brauchen, sowieso ist eine relativ merkwürdige Behauptung: Denn keine Person würde mir ‘weil sie nichts zu verbergen hat’ ihre Mail- oder Social-Media Passwörter geben. Oder um es auf die Spitze zu treiben, könnte man gerade so gut Wohnungs- und Briefkastenschlösser entfernen, da man auf diese Weise ja die eigene Wohnung oder Post verbirgt.
Verhalten unter Beobachtung
Eine intuitive Wahrheit, welche auch bereits von diversen Sozialwissenschaftlichen und psychologischen Studien bestätigt wurde, ist, dass unser Verhalten sich verändert, wenn wir uns beobachtet fühlen. Wir stehen einem «Blick» gegenüber, der je nach eigenem Verhalten ein Gefühl von Scham auslösen könnte. Umso grösser ist auch der Druck bei Vorhandensein eines solchen Blicks, sich so zu verhalten, wie es erwartet wird, zu konformieren. Dabei ist es nicht einmal notwendig, dass ein solcher Blick existiert. Es reicht bereits, wenn man denkt, dass man gesehen wird.

Diesem Gedanken folgend entwarf der englische Sozialphilosoph Jeremy Bentham im 18. Jahrhundert die Idee des «Panoptikons». Dieses beschreibt einen Aufbau eines Gefängnisses, in welchem alle Insassen von einem einzigen Wächter überwacht werden können. Dabei wissen die Gefangenen selbst nicht, ob sie zu einem beliebigen Zeitpunkt überwacht werden. Da jedoch stets die Möglichkeit dazu besteht, verhalten sie sich konform und so wie es von ihnen als Insassen erwartet wird. Im 20. Jahrhundert erweiterte Michel Foucault diesen Gedanken so weit, dass die Idee des Panoptikons grundsätzlich auf jede Institution anzuwenden sei, die danach trachtet menschliches Verhalten zu kontrollieren. Also Institutionen wie beispielsweise Schulen, Kliniken oder Fabriken. Diese Struktur, argumentierte dieser, sei der Schlüssel zur sozialen Kontrolle moderner Gesellschaften.
Bedeutung der Privatsphäre
So hat Privatsphäre weniger mit der Absicht zu tun, Dinge vor anderen zu verbergen, sondern damit eine individuelle Freiheit unabhängig von äusserer Kontrolle zu besitzen, also unabhängig eines äusseren «Blicks». Denn Mittel wie Massenüberwachung oder Vorratsdatenspeicherung bieten die perfekte Infrastruktur für ein globales Panoptikon, welches mit privaten Firmen oder Staaten als «Wächter» operiert. Diese können womöglich die besten Absichten haben, jedoch hat man dafür nie eine Garantie. Umso mehr Bedeutung gewinnt die Privatsphäre auf diese Weise als Mittel zur Freiheit. Selbst wenn man diese nicht aktiv spürt, schränken solche Strukturen die Freiheit des Einzelnen enorm ein. Oder in den Worten von Rosa Luxemburg: «Wer sich nicht bewegt, der spürt seine Fesseln nicht.»
Welche Fesseln es gibt und welche Bedeutung diese Fesseln konkret auf die individuelle Freiheit haben, folgt nächste Woche im zweiten Teil der Artikelserie zum Thema Datensicherheit.