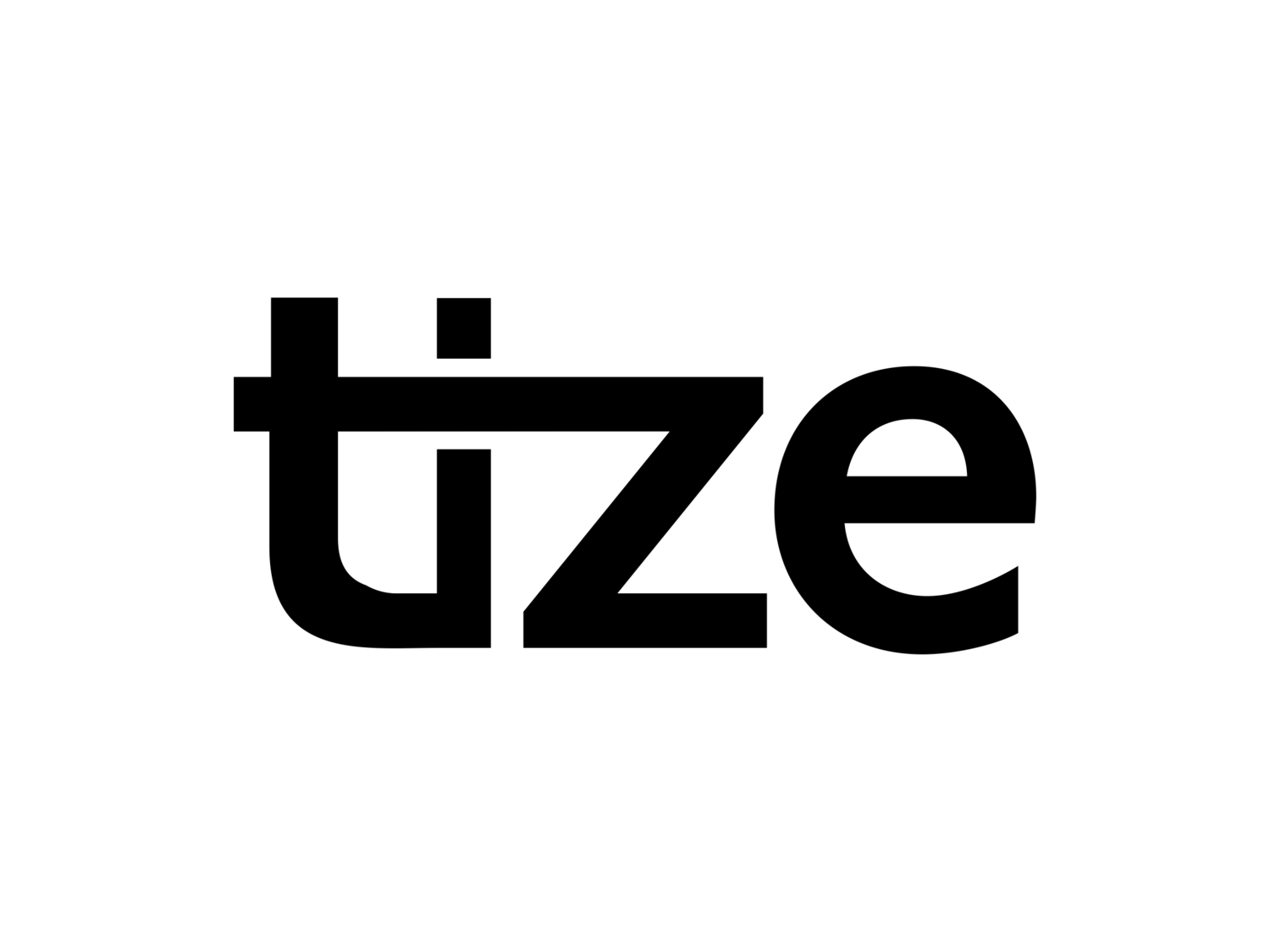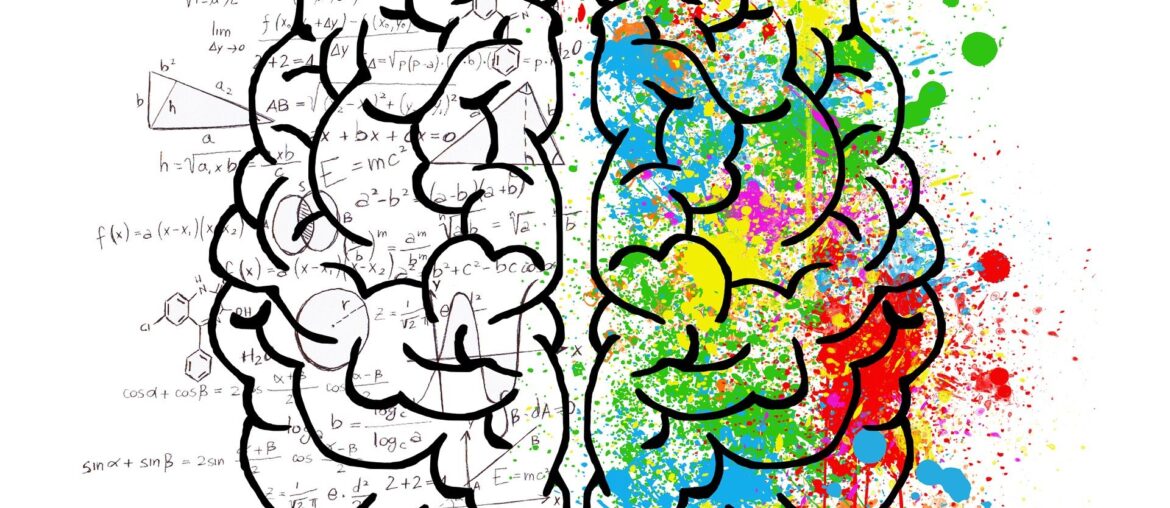«Haribo macht…». Ich muss den Satz nicht einmal zu Ende schreiben, weil unser Gehirn den Werbespruch automatisch ergänzt. Es ist eines von vielen Beispielen, wie ausgeklügelte Werbungen in unseren Köpfen den Platz einnehmen. Oft sind sie so raffiniert gemacht, dass wir es nicht einmal merken. Auch wenn wir es nicht wahrnehmen, so steckt in den Anzeigen eine ganze Reihe psychologischer Tricks.
Das Wort Psychologie kennen doch fast alle. Ich nehme an, man hat es auch schon selbst verwendet. Aber weiss man denn auch, was sich alles hinter diesem eher komplexen Fremdwort verbirgt? Hier ein kleiner Exkurs in die riesengrosse Welt der Psychologie.
Die Woche ist schon halb vorbei und bald steht wieder das Wochenende vor der Tür. Man freut sich darauf, seine Freunde zu treffen, den Hobbies nachzugehen oder vielleicht auch einfach darauf, eine Stunde länger im Bett zu bleiben. Doch spätestens am Sonntagabend schleicht es sich wieder an – das Gefühl der Unruhe, welches einen bis zum nächsten Wochenstart nicht wieder loslässt. Doch wieso ist das so und wie entsteht dieses Wochentief?
Was ist der Sinn des Lebens? Im Buch «Man’s Search For Meaning» beschreibt der Psychiater Viktor E. Frankl seine Erlebnisse in vier verschiedenen Nazi Konzentrationslager und versucht, diese Frage zu beantworten.
Im Alltag müssen wir uns Menschen oftmals mit Entscheidungen auseinandersetzen. Dies passiert zu Hause, in einem Restaurant sowohl auf der Arbeit oder in der Schule. Oftmals hört man von Leuten, sie haben «aus dem Bauch heraus» entschieden, also eine Entscheidung nach Bauchgefühl getroffen. Was bedeutet das eigentlich und warum weiss unser Bauch mehr als wir wissen? In diesem Artikel befassen wir uns mit mit diesem oft unterschätzten und oftmals belächelten Instinkt.
Auch wenn es aktuell schon Lockerungen gibt, sind wir immer noch von Einschränkungen und Veränderungen betroffen. Social Distancing ist nach wie vor das Gebot der Stunde. Die soziale Isolation und die Einschränkungen lösen Stress und ein Gefühl von Einsamkeit aus. Auch die Ungewissheit, wann wieder mehr Normalität einkehren wird und wie sich unser Leben verändern wird, bereitet vielen Sorgen. Gerade in Zeiten wie diesen ist es deshalb besonders wichtig, auf die mentale Gesundheit zu achten.
Jede fünfte Person ist Statistiken zufolge davon betroffen und dennoch hört man kaum davon: SPS (kurz für Sensory Processing Sensitivity) steht für eine erhöhte sensorische und emotionale Wahrnehmung in der Psyche eines Menschen. Auch der 21-jährige Elia Catena ist von diesem Phänomen betroffen und erklärt, was Hochsensibilität genau ist und wie ein junger Mann im 21. Jahrhundert damit umgeht. Hochsensibilität auf den Punkt gebracht – diesen Monat bei Tize klärt auf.
«Interessant ist, dass sehr viele Menschen hochsensibel sind, davon aber keine Ahnung haben.» Der in Solothurn lebende Elia Catena ist hochsensibel und geht offen damit um. Begeistert, von diesem psychologischen Phänomen erzählen zu können, erklärt er, was genau im Innern eines Hochsensiblen vor sich geht. Neurologen gehen davon aus, dass Menschen mit einer hochsensiblen Veranlagung eine erhöhte neurologische Aktivität im Bereich der Sinneswahrnehmung aufweisen, wie Elia erklärt. Er selbst arbeitete bis letzten Dezember in einer Institution für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, wo er auch seine Ausbildung abschloss. «Ich habe mich schon immer sehr für das Selbst des Menschen interessiert und habe damit begonnen, mich neben der Arbeit mit mir selbst auseinanderzusetzen, was wirklich bereichernd war.»
«Interessant ist, dass sehr viele Menschen hochsensibel sind, davon aber keine Ahnung haben.»
Elia, was genau bedeutet es für dich, hochsensibel zu sein?
«Mit der Hochsensibilität konnte ich mich und meine Persönlichkeit besser einordnen. Ich habe nun einen Identifikator, was mir etwas Erleichterung im Auf und Ab des Lebens bietet, kann mich ein Stück weit damit identifizieren und fand somit ein weiteres Puzzleteil meines Ichs.» Er habe schon in der Pubertät gemerkt, dass bei ihm etwas anders ist als bei den meisten anderen. «Ich bin ein Mensch, der erst sehr spät wusste, was aus mir werden sollte und so ganz habe ich diesen Prozess auch noch nicht abgeschlossen. Aber mit der Eigendiagnose der Hochsensibilität hat für mich plötzlich alles Sinn ergeben. Es fühlt sich an, als hätte ein weiteres Puzzleteil zur Vervollständigung meines Selbst gefunden, das gibt mir auch einen gewissen Halt.»
Elia erklärt, wie er die verschiedensten alltäglichen Situationen wahrnimmt: «Hochsensibilität zeigt sich auf unzählig verschiedene Arten. Es ist sehr schwer Hochsensibilität zu verallgemeinern, vor allem aufgrund der menschlichen Diversität. Ich nehme emotionale Sinneseindrücke sehr intensiv wahr. Zum Beispiel spiegle ich die Gefühlszustände von anderen Personen wider und fühle diese gleichzeitig sehr stark. Wissenschaftler haben erwiesen, dass für das Widerspiegeln von Gefühlszuständen die sogenannten «Spiegelneuronen» verantwortlich sind, diese sind auch für das Empathievermögen zuständig. Das kann manchmal schon überfordernd sein, besonders wenn ich von mehreren Menschen umgeben bin, die mir nahestehen. Da fällt es mir leichter, Gefühle nachzuempfinden. Es ist aber auch ein Vorteil, denn ich kann dadurch Menschen in schwierigen Lebenssituationen besser beistehen, weil sie sich von mir Verstanden fühlen. Natürlich kann ich auch Glücksmomente nachfühlen, was sehr schön ist.»
Welche Arten von Hochsensibilität gibt es?
Wie Elia sagt, wird zwischen drei verschiedenen Arten der Hochsensibilität unterschieden. «Da wäre der sensorisch sensible Mensch, der emotional Sensible (der vor allem auf Gefühlszustände reagiert) und der kognitiv Sensible. Letzterer prägt ein hohes Verständnis für Logik und komplexere Zusammenhänge. Ich muss dazu sagen, dass eine hochsensible Person nicht nur eine dieser Arten aufweist, sondern mehrere einzelne Symptome gleichzeitig auftreten. Eine dieser Arten ist lediglich die Dominierende.» Bei ihm seien vor allem die Bereiche der Kinästhetik, des Geruchsinns und des Agierens innerhalb einer Gruppendynamik dominierender. «Schon nur wenn ich an einem gemütlichen Samstagabend in einer Gruppe unterwegs bin, laufen meine inneren Sensoren auf Hochtouren. Ich spüre bei allen Gruppenmitgliedern, wie diese sich fühlen und versuche das Geschehen so zu steuern, dass alle einigermassen zufrieden sind. Sind alle zufrieden, fühle auch ich mich wohler und kann mich der Gruppendynamik anschliessen.»
Wie hast du gemerkt, dass du hochsensibel sein könntest?
Schon im Kindesalter haben ihm seine Eltern und andere Mitmenschen gesagt, dass er ein sehr sensibles Kind sei. «Das war überhaupt nie abwertend gemeint. Die meisten waren sehr dankbar dafür und respektierten mich.» Doch Elia wollte sich zu diesem Zeitpunkt nicht mit sich selbst auseinandersetzen. «Es gab Phasen in der Pubertät, in denen ich mich selbst dafür verflucht habe und mich fragte, was denn nicht mit mir stimmte. Ich denke das geht zu Beginn vielen so.» Der eigentliche Auslöser war aber eine Freundin, die Elia im Laufe seines Lebens kennengelernt habe. «Diese Person ist mir sehr ans Herz gewachsen und hat mich von Anfang an unterstützt.» Sie hatte sich aus Interesse mit dem Thema auseinandergesetzt und mit Elia etliche Gespräche darüber geführt. «Zu meinem Geburtstag hat mir die genannte Freundin das Buch «Proud to be Sensibelchen» von Maria Anna Schwarzberg geschenkt. Ich konnte mich sofort mit beinahe allem identifizieren, was in diesem Buch geschrieben steht. Somit war für mich der Fall klar: Ich bin hochsensibel.»
«Somit war für mich der Fall klar: Ich bin hochsensibel.»
Wie würdest du das Gefühl beschreiben, das mit der Eigendiagnose in dir ausgelöst wurde?
«Es war nicht befreiend, eher öffnete es mir die Augen, wenn ich so an vergangene Geschehnisse und mein Leben im Allgemeinen zurückdenke. Wie schon erwähnt, fand ein weiteres «Puzzleteil», das brachte mir grosse Erleichterung. Gleichzeitig wurde ich so vor neue Herausforderungen gestellt und ich begann ich mich mehr mit mir auseinanderzusetzen.» Elia sei sehr dankbar für diese Erfahrung, wie er sagt. Um mehr über das Thema zu erfahren habe er sich anschliessend verschiedene Podcasts angehört und liess sich Konflikte mit seinen Freunden aus der Vergangenheit durch den Kopf gehen. «Es war sehr interessant, welchen neuen Blickwinkel ich plötzlich auf die verschiedensten Dinge hatte.»

Was sagt dein Umfeld dazu, wenn du erklärst, dass du hochsensibel bist?
Seiner Familie sei bereits klar gewesen, dass Elia hochsensibel sein könnte. «Ja klar, das wissen wir und weiter?», so hätten beispielsweise seine Eltern reagiert. «Viele aus meinem Umfeld, gerade enge Freunde, reagieren mit grossem Verständnis und sind so fasziniert davon, dass sie am liebsten alles darüber erfahren würden. Das erleichtert mich sehr und gerne füttere ich dieses Bedürfnis auch und berichte von meinen Erfahrungen.» Daneben gebe es auch solche, die mit Unverständnis reagieren. «Das ist für mich vollkommen in Ordnung, damit kann ich leben», versichert Elia.
In welchen Bereichen des alltäglichen Lebens schränkt dich deine Hochsensibilität ein?
«Grösstenteils werde ich nicht eingeschränkt. Die Hochsensibilität ist ein Teil von mir und ich muss mich arrangieren. Ich sehe es mehr als Möglichkeit. Trotzdem kann es gerade bei grösseren Gruppen, in denen ich mich bewege, vorkommen, dass ich mich plötzlich unwohl fühle und ich erst einmal herausfinden muss, welche Reize mich überfordern.» Das nützt Elia aus, um kurz den «Siedepunkt» zu verlassen, rauszugehen und sich zu sammeln. «Das schränkt mich schon ein, da ich halt die Gruppe für eine kurze Zeit zurücklassen muss», ergänzt er. «Ich kann dann auch ohne Problem sagen, dass es mir zu viel wurde. Ich finde, dass sollte jeder Mensch machen und sagen dürfen, ob hochsensibel oder nicht.»
Kennst du Leute in deinem Umfeld die hochsensibel sind und wie gehst du mit denen um?
«Es gibt viele in meinem Freundeskreis, die entweder hochsensibel sind oder vereinzelte Symptome aufweisen. Mit der einen Freundin, die ebenfalls hochsensibel ist, spreche ich oft über das Thema. Generell pflege ich aber keinen speziellen Umgang mit den Leuten. Im Gegenzug erwarte ich auch nicht, dass mein Umfeld anders mit mir umgeht.» Elia sieht auch gewaltige Unterschiede, wenn er sich mit anderen Hochsensiblen vergleicht. «Das Spektrum der Hochsensibilität ist so riesig, dass es schwierig ist Differenzen zu Menschen mit gleicher oder ähnlicher Thematik zu erkennen. Spannender finde ich, Gemeinsamkeiten untereinander ausfindig zu machen. Der emotionale Sinn ist nach meinen Beobachtungen der, der bei den Leuten in meinem Umfeld am ausgeprägtesten ist.» Durch den regelmässigen Austausch könne man eine Reflexion provozieren. Diese Selbstreflexion sei im Umgang mit Hochsensibilität essenziel.
«Man ist ein gewöhnliches Individuum mit individuellen Charakterzügen.»
Hast du Ratschläge für Menschen, die bereits hochsensibel sind oder das Gefühl haben, sie könnten auch zu diesem Spektrum gehören?
«Tests dazu machen, das kann einem Sicherheit vermitteln. Mir persönlich hat das sehr geholfen.» Er rät den Betroffenen, sich selbst zu akzeptieren und sich ein wenig zu beobachten. «So kann eingeschätzt werden, in welchen Lebensbereichen die Hochsensibilität zutrifft, wo Unterstützung angefordert werden kann und wie am besten Selbsthilfe betrieben wird.» Massgebend sei, durch eine Eigendiagnose nicht in Hochmut oder im Gegenteil, Selbstmitleid zu verfallen. «Ein hochsensibler Mensch ist weder besser noch schlechter. Man ist ein gewöhnliches Individuum mit individuellen Charakterzügen», fügt Elia hinzu.
Wie findest du, wird mit dem Thema in der Öffentlichkeit und in der Politik umgegangen?
«Generell finde ich, wird Hochsensibilität zu wenig thematisiert. So müssen insbesondere die stärker betroffenen selbst damit umgehen und erst einmal selber auf die Diagnose kommen, statt Hilfe von aussen erwarten zu können. Das kann dann zum Problem werden, wenn sich Personen regelrecht fragen, was denn nicht mit ihnen stimme, so wie es bei mir in der Pubertät war.» Im Gleichzug findet Elia aber auch, dass es wichtigere Themen als die Hochsensibilität gibt. Dazu sagt er: «Hochsensible Menschen können nichtsdestotrotz ohne weitere Probleme ihr Leben bestreiten, es ist in diesem Fall keine Krankheit oder Behinderung, sondern eine etwas ausgeprägtere Eigenschaft.»
«Wer hochsensibel ist, hat keine extra Wurst!»
Was für Elia gar nicht geht ist, wenn Menschen ihre Hochsensibilität als Ausrede verwenden. «Es ist keine Ausrede für gar nichts und verpflichtet niemanden, dass er mit der betreffenden Person anders umgeht. Wer hochsensibel ist, hat keine extra Wurst!» Trotzdem sei es wichtig, dem Thema offen zu begegnen. «Wenn ich aber jemandem erzähle, dass ich hochsensibel bin und dabei auf Desinteresse stosse, sollte mir das als Betroffener nichts ausmachen. Gegenseitiger Respekt ist wie bei so vielem, das A und O.»
Willst du zum Schluss den Leserinnen und Lesern von Tize etwas auf den Weg geben?
«Diejenigen die mich kennen, lade ich herzlich dazu ein, mich bei weiteren allfälligen Fragen zu löchern. Ich gebe sehr gerne Auskunft, wie Tipps und Tricks zum Thema.» Auch an die Leserschaft, die sich mit der Hochsensibilität identifizieren kann, hat Elia eine Botschaft: «Macht euch nicht selbst fertig, akzeptiert eure Persönlichkeit und seid offen. Es ist ein spannendes Thema und es lohnt sich, sich damit zu befassen.
Wir danken Elia für das interessante Gespräch.
Die Reihe «Tize klärt auf»: Jeden letzten Montag im Monat erscheint auf Tize ein neuer Bericht über brandaktuelle, häufig diskutierte und spektakuläre Themen in allen möglichen Bereichen, dargestellt mit Analysen, Aufzeichnungen oder Interviews – von der jungen, für die junge Generation.
Hier geht’s zur ganzen Reihe: Tize klärt auf