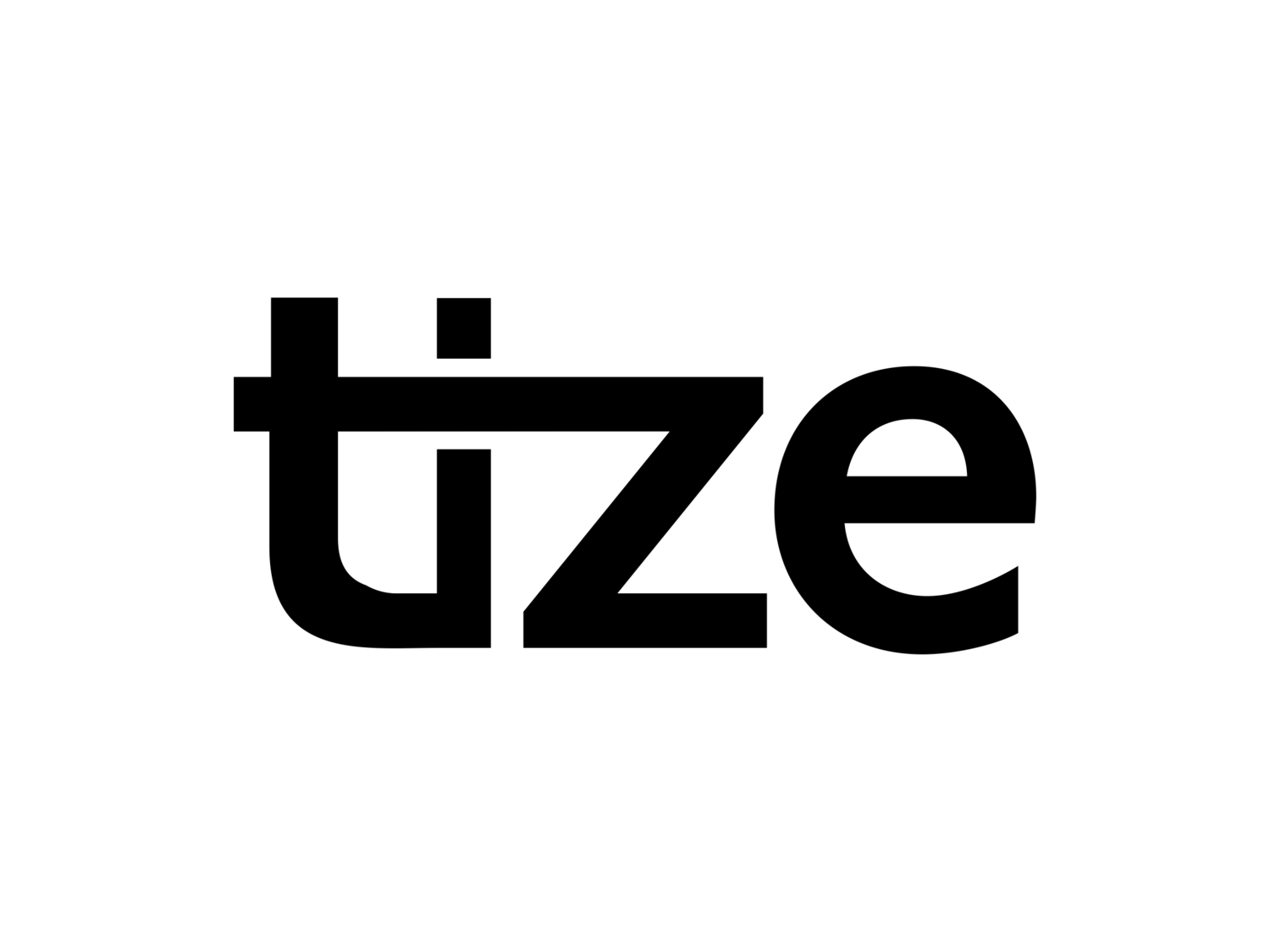Cécile Kienzi hat sich Anfang 2021 fürs Militär entschieden und mit ihrer Vertragsunterschrift eingewilligt, das Land im Ernstfall zu beschützen. Ich hatte das Glück sie interviewen zu dürfen.
Ein Leben als Flüchtling ist etwas, das vielen von uns zum Glück nie bei eigenem Leibe erleben mussten. Andauernd hören wir von Flüchtlingen – damals bei der grossen Flüchtlingskrise in 2014 und nun von den Ukrainischen Flüchtlingen. Doch das meiste, das wir davon hören, sind die Zahlen. Wie viele neue Flüchtlinge gibt es? Wir klassifizieren sie nach Flüchtlingsgrund und sehen sie als eine Flüchtlingsgruppe an, doch nicht mehr als Individuum. Das Leid, das diese Flüchtlinge erleben, ist uns oftmals gar nicht richtig bewusst und auch wenn wir ihre Geschichten hören, können wir uns ein solch schreckliches Schicksal kaum vorstellen. Und dennoch ist es wichtig, diese Geschichten zu hören. Es ist wichtig, uns bewusst zu werden, wie schrecklich das Schicksal bestimmter Menschen ist, oftmals nur wegen der Kriegslust von uns Menschen.
Das Schicksal, von dem hier berichtet ist, ist das Schicksal eines Afghanen. Nennen wir ihn Massih, um seinen wahren Namen nicht zu erwähnen. Vor drei Jahren durfte ich ihn bei einem Asyltreff kennenlernen, als wir mit der Kirche die dort angebotenen Deutschkurse besuchten. Es war das erste Mal, das ich wirklich aufmerksam wurde auf das Leben dieser Flüchtlinge.
Nun, nach knapp drei Jahren, treffe ich Massih endlich wieder. Ein anständiger Mann, mit seinen etwa 1.60 Metern kaum gross, doch mit umso mehr Erlebnissen, die er zu erzählen hat. Obwohl seine Augen mich glücklich anschauen, sind sie umrandet von Falten. Das ganze Gesicht – trotz seines jungen Alters ist es voller Falten. Auch wenn ich mich freue, ihn wieder zu sehen, erfasst mich eine gewisse Traurigkeit, denn seine Augen erzählen bereits so viele Geschichten, zu denen er mir später mehr erzählt.
Obwohl mein Leben im Vergleich zu dem seinen nicht viel Spannendes zu berichten hat, fragt er mich danach. Wir unterhalten uns über Belanglosigkeiten wie das Boxen. Doch nach einer gewissen Zeit fängt er an, über sein Leben zu reden. Prompt stockt er jedoch wieder und fragt mich: «Stört oder langweilt es dich aber auch ganz sicher nicht, wenn ich dir über meine Vergangenheit erzähle? Sie ist nicht wirklich schön.» Sofort schüttle ich den Kopf. Und dann beginnt er zu erzählen.
Mit seiner Familie hat Massih schon mehrere Monate Kontakt mehr. Das letzte Mal, als er seine Mutter finanziell unterstützen musste, da sie eine Operation brauchte. Seit seiner Flucht hat er seine Familie nie mehr gesehen. Nicht einmal Bilder von ihnen bleiben ihm noch, denn diese hatte er alle auf einem Memorystick. Einem Memorystick, den er leider verloren hat, einem Memorystick, wo all seine Bilder seit seiner Jugend drauf waren. Nun gibt es keine Überbleibsel mehr von seiner Vergangenheit ausser seiner eigenen Erinnerungen. Erinnerungen, die vielleicht zu seinem eigenen Besten vielleicht auch gleich in Vergessenheit hätten geraten sollen. Doch sie sind noch hier und machen aus Massih diesen Menschen, der er nun ist.
Massih kam in einer Familie zur Welt mit einem älteren Bruder und drei jüngeren Schwestern. Inzwischen haben sie alle eine Familie, doch die meisten seiner Neffen und Nichten konnte Massih nie kennenlernen. Im Alter von nur 15 Jahren wurde er schon verlobt mit seiner Cousine. «Sie ist wirklich hübsch und intelligent, doch wir beide wollten das gar nie», sagt Massih zu mir. Dass er sich verloben soll, wurde von seinem Vater und seiner Tante entschieden. Seine Tante hatte keinen einzigen Sohn und bat ihren Bruder deshalb um seinen Sohn. Die beiden Kinder fanden sich damit ab, bis sie wirklich heiraten würden, würden sowieso noch einige Jahre vergehen.
«Als ich endlich in der Schweiz angekommen bin, sagte ich ihr, dass wir uns trennen sollen. Unsere Beziehung war eh nie mehr als der Entscheid unserer Eltern und als streng-muslimische Frau hätte sie es nicht leicht gehabt hier in der Schweiz. Nach dem hatte ich keine Beziehung mehr. Inzwischen wünschte ich mir das. Ich wünschte, ich hätte eine Familie. Ich fühle mich so alleine.»
Diese Worte lösten eine gewisse Trauer in mir aus. Denn Massih ist so viel gereist in seinem Leben, dass er nie die Möglichkeit hatte, sich wirklich an einen Menschen zu binden. Stets musste er von einem Ort zum anderen fliehen. Und nun, da er endlich seit etwa sechs Jahren sesshaft ist in der Schweiz, hat er niemanden. Er ist schon Mitte dreissig, um eine Familie mit Kindern zu haben, wird es also immer mehr und mehr zu spät.
Die beiden waren schon einige Zeit lang zusammen verlobt, als der Krieg in Afghanistan sie immer mehr und mehr betraf. Massih diente einige Monate im Militär, eine äusserst strenge Zeit, wie er hinzufügt. Da er weiss, dass ich schiesse, erzählt er mir sogleich: «Als ich im Militär war, konnte ich mit verschiedensten Waffen schiessen. Das Ganze macht wirklich Spass», lächelt er. Sogleich fügt er jedoch hinzu: «Aber nur wenn man auf eine Zielscheibe schiesst, aber niemals wenn man auf Menschen schiesst!» Die Jahre im Militär sind die letzten Momente, die er noch in seinem Heimatland verbringen durfte. Sein Bruder diente sieben Jahre im Militär, inzwischen ist er jedoch auch wieder fertig damit. Der Vater starb wegen einer Bombe im Krieg.
Die Zeit zu flüchten war für Massihs Familie gekommen. Zusammen flohen sie alle in den Iran, wo bis heute der Rest seiner Familie bleibt. Zur Zeit der Flucht hatte Massih nur sechs Jahre Unterricht gehabt und bekam danach nie wieder in seinem Leben die Möglichkeit, die Schule immerhin bis zu einem Schulabschluss weiter zu besuchen.
Da Massih im Militär gedient hat, musste er jedoch auch schnell wieder aus dem Iran fliehen. Das war der Wendepunkt seines Lebens, ab dem er nur noch sich selbst hatte. Wo bis zu diesem Augenblick hin seine Familie stets dabei gewesen war, musste er sich nun ganz alleine durchkämpfen. Der Weg begann in den Wäldern des Irans. Wochenlang musste er durch diese hindurchgehen. Er hatte kein Essen, kein Trinken, keine Begleiter. Er hatte gar nichts. Ganz auf sich alleine gestellt musste er diese Wälder also durchgehen, ernährte sich nur von dem, das er irgendwie irgendwo finden konnte. Obwohl er völlig unterernährt war, musste er die ganze Strecke laufen und sogar joggen. Weiter, weiter und immer nur weiter – mehr gab es in diesem Moment nicht. Sobald er die Polizei sah, musste er sich sogleich wieder in den Tiefen des Waldes verstecken.
Doch endlich kam er an die Küste. Von hier aus schaffte er es, mit einem Schiff bis nach Griechenland zu gelangen. Griechenland war jedoch nicht sein Ziel, so versuchte Massih, nach Italien zu gelangen. Er entdeckte eine Fähre und versteckte sich unter einem Lastwagen. Doch kaum in Italien angelangt, entdeckte ihn die Polizei. Sofort wurde er zurückgeschickt, zurück nach Griechenland.
Damals war das Jahr 2014 – das Jahr der Flüchtlingskrise. Wir erinnern uns alle an die Bilder, die wir damals von Griechenland zu sehen bekamen – überfüllte Flüchtlingscamps. Zu wenig Essen. Zu wenig Hygiene. Zu wenig Hoffnung für die Menschen. Genau in dieses grosse und allbekannte Camp kam Massih. Ein Gefängnis – so beschreibt er es.
Das Lager ist wie ein Gefängnis. Zu viele Menschen, zu viel Leid und man darf es nicht mal verlassen. Man ist eingesperrt wie ein Verbrecher, obwohl man doch gar nichts verbrechen wollte.
Massih über das Flüchtlingscamp in Griechenland
Eigentlich hätte er viel länger dort bleiben sollen, doch zu seinem Glück blieb er nicht länger als ein paar Monate dort. Sobald er es erst einmal aus dem Camp rausgeschafft hatte, versuchte er sein Glück nochmals auf einer Fähre. Diesmal entschied er sich jedoch nicht für einen grossen Lastwagen, sondern für einen kleinen Car mit weniger als einem Duzend Reisenden. Mithilfe eines Kopftuches band er sich an der Unterseite an – und verharrte dort für die nächsten 24 Stunden. Keine Nahrung, kein WC, keine Bewegung. Regungslos lag er da, festgemacht an seinem einzigen Hoffnungsträger, den er noch hatte.
Und endlich schaffte er es nach Italien. Sobald die Fähre anhielt, ging es nicht lange, bis die Car-Reisenden in bemerkten. Doch sie waren so in Schock über diesen Schwarzfahrer, dass sie nur ein Foto schossen und ansonsten nichts taten. Sobald er das Kopftuch gelöst hatte, rannte Massih schnell davon, so weit er konnte. Als er in einem nahe gelegenen Wald endlich alleine zu sein schien, konnte er endlich wieder anhalten. Sofort schmiss er sich auf den Boden, denn alle Energie hatte ihn verlassen. Nach so vielen Stunden voller Reglosigkeit und Hunger konnte er keine weitere Energie mehr aufbringen und lag still da. Genoss den Boden des neuen Landes unter sich, auch wenn er wusste, dass seine Reise noch lange nicht fertig war.
Es vergingen nicht mehr als zwei Stunden, las plötzlich ein Mann zu ihm stosste. «Wodurch geht es nach Rom?», fragte Massih ihn. «Nach Rom?», fragte der Fremde ihn, «bist du gerade fertig geworden mit deiner Arbeit?» Der Fremde strahlte ein gewisses Vertrauen aus und sogleich erzählte Massih ihm, dass er nicht ein Arbeiter, sondern ein Flüchtling war. Geschockt schaute ihn der Fremde ein. «Du weisst, dass hier jederzeit Polizisten auftauchen können? Du musst dich verstecken, ansonsten wirst du gleich zurückgeschickt!» Das war der Beginn einer kurzen, doch sehr tiefen Freundschaft. Massih lernte viel über das Überleben als Flüchtling bei diesem Fremden und bekam Unterstützung, wo nur möglich. Er hatte damals nur zwei Kleidungsstücke bei sich, die er beide gleichzeitig am Leibe trug. Denn auf der Reise konnte er nicht, nicht einmal eine kleinste Tasche mitnehmen. Der Fremde wusch ihm die Kleider, pflegte ihm die Wunden. Ein wahrer Engel, der in der schlimmsten Zeit für Massih da war.
«Dieser Mensch war gut. Er half mir, als ich niemand anderen hatte», erzählte Massih mir. Doch so sehr der Fremde nur das Beste für ihn wollte, musste er durch den Fremden auch einige schmerzliche Entscheidungen treffen. So musste er sein Handy wegwerfen, seinen Pass und all seine anderen Papiere. Es sind nur materielle Sachen, mag man meinen, doch es war seine Identität. Mit dem Wegwerfen seines Passes verlor er seinen Namen, seinen Geburtstag, ja alles.
«Als ich später dann in der Schweiz war, konnte mein Dolmetscher meine Sprache nicht richtig und so trug man mir den ersten Januar als Geburtstag ein», lacht Massih. «Viele Menschen sagen, was für ein toller und einfacher Geburtstag. Ich sage dann immer, dass das nicht mein richtiger Geburtstag ist. Doch die beim Amt wollen das Datum nicht ändern, bis ich einen Pass mit dem richtigen Geburtstag vorweisen kann. Und meinen Pass habe ich seit diesem Tag nicht mehr. Einen neuen kann ich mit der momentanen Situation jedoch auch nicht anfordern. Ich hoffe, ich kann es einfach irgendwann wieder tun.»
Nur wenige Tage vergingen, da verliess Massih den fremden Helfer in Italien wieder. Seine Reise ging weiter nach Rom, von wo aus er über die Schweiz bis schlussendlich Finnland gelangen wollte, da er dort einen Freund hatte. Mit dem Zug fuhr er schwarz bis in die Schweiz ein, doch er wurde im Zug sofort kontrolliert. Als die Kontrolleure merkten, dass er kein Billet hatte und wohl nicht von hier war, nahmen sie sogleich einen Fingerabdruck von ihm. Somit war er für immer im System registriert. Man gewährte Massih daraufhin zwar das Asyl, doch er durfte die Schweiz nicht mehr verlassen. Sobald er einmal über die Grenze ginge, sollen die Schweizer Grenzen für immer geschlossen sein für ihn.
«Ich kann weder meine Familie besuchen, noch nach Deutschland oder in ein anderes Nachbarsland gehen», erzählt Massih mir. «Wie gerne würde ich doch einmal in ein anderes Land in die Ferien gehen. Doch leider darf ich das bis jetzt nicht. Vielleicht habe ich dieses Jahr Glück und bekomme statt eines F-Ausweises den B-Pass. Mit diesem dürfte ich dann ins Ausland.»
F-Ausweis – die Arbeit ist ihm erlaubt, vieles ist ihm erlaubt, doch er ist für immer in den Schweizer Grenzen gefangen, bis er einen anderen Ausweis erlangt.
Ein neuer Abschnitt im Leben von Massih begann, als er hierher kam. Zuerst fand er natürlich nicht sofort Arbeit und es war ihm ganz am Anfang auch noch nicht gestattet. So lebte er von der Sozialhilfe: Eine kleine Wohnung wurde ihm bereitgestellt. Dazu 70 Franken pro Woche. Für das Essen, für die Kleidung, für all den Unterhalt. 70 Franken – also nicht mehr als 10 Franken pro Tag.
Immerhin hatte Massih nun einen Ort, von dem er nicht mehr weiterflüchten muss, auch wenn es nie sein Ziel war. Immerhin hat Massih hier nun Sicherheit. Inzwischen hat
Doch zu was für einem Preis? So vieles musste Massih in dieser schrecklichen Flucht hinter sich lassen. Den Traum, nicht alleine zu sein. Den Traum, eine Familie zu gründen. Den Traum, eine anständige Schule besuchen zu können und später zu studieren – Computer Sciences war seit seiner Kindheit immer sein grosser Traum gewesen, teilt er mir mit. Das Bedürfnis, verstanden zu werden. Das Bedürfnis, immerhin eine Identität zu haben.
Das Schweizer Militär gerät des Öfteren in Kritik. Es koste zu viel, wäre unnötig und überhaupt: Die Schweiz wäre doch viel zu unwichtig, weshalb sollte ein so kleines Land angegriffen werden? All das sind Kritikpunkte, die in alltäglichen Diskussionen immer wieder auftauchen und auch während den diesjährigen Wahlen, gerieten die «grünen Ferien» desöfteren in Beschuss. Wie wichtig ist eine Armee für ein kleines Land wie die Schweiz und welchen Stellenwert hatte sie in der Vergangenheit?