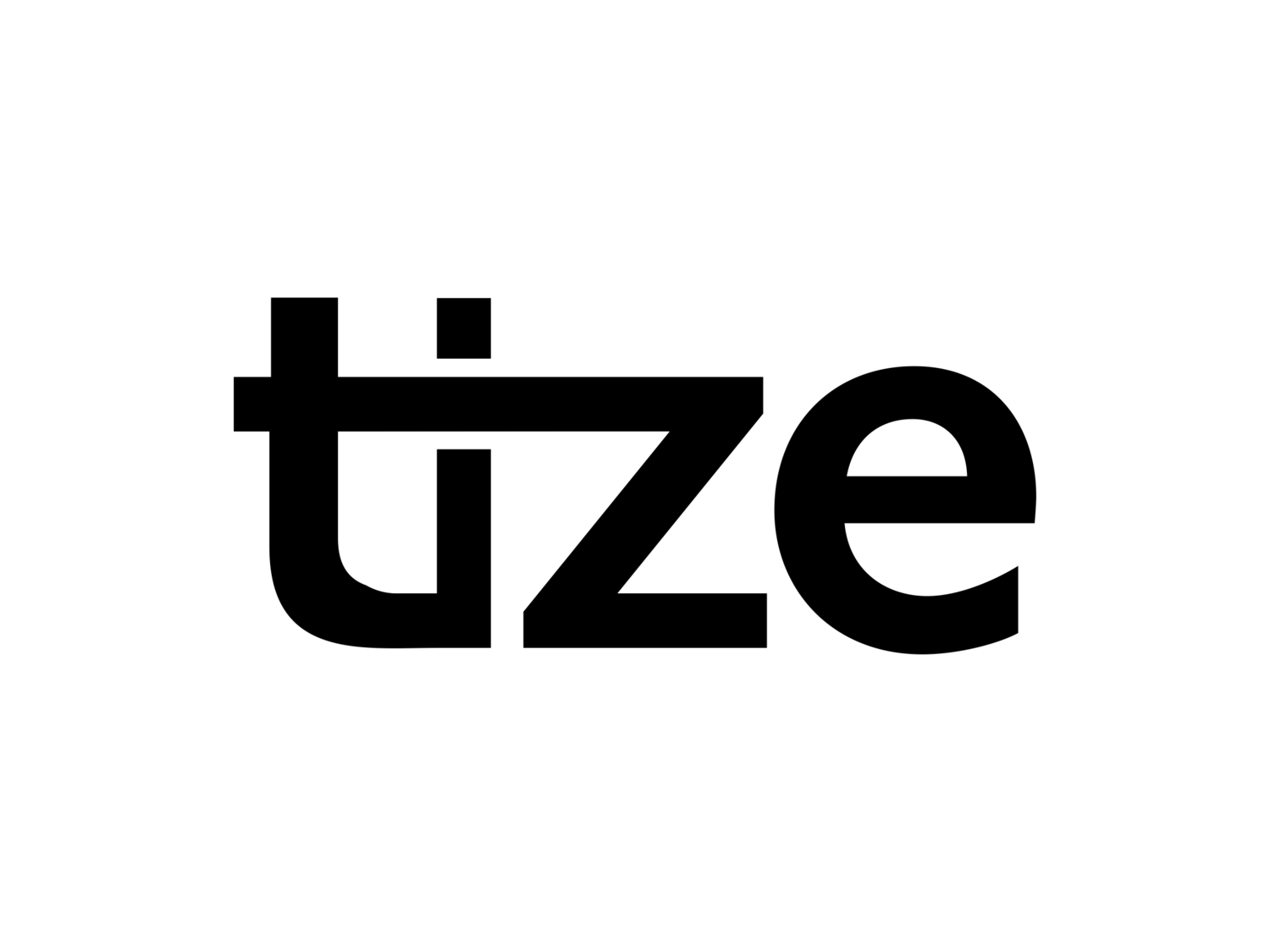Während die Welt mehrheitlich mit dem Coronavirus beschäftigt ist, erreicht der Konflikt in Syrien eine neue Eskalationsstufe. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat vor wenigen Wochen die Grenze zu Syrien offiziell geöffnet. Die Folge: Tausende schutzsuchende Syrierinnen und Syrier flüchten über die Türkei, um nach Europa zu gelangen. Doch der Exodus endet für die meisten bereits nach dem Bosporus. Wie die humanitäre Krise auf Lesbos und anderen Grenzorten entstanden ist – heute auf Tize.ch.
Es sind Szenen, die einem apokalyptischen Film zu entspringen scheinen: Nach Focus befinden sich zurzeit über 20`000 Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos. Die meisten haben ihre Schlafplätze mittlerweile über die ganze Insel verlegt, denn das Hauptlager fasst eine Kapazität von nur 2`800 Menschen. Die Insel, die früher als Urlaubsparadies galt, wird nun vom Elend eines neun Jahre anhaltenden Bürgerkrieges überflutet und selbst für Einheimische zum Horror. Den Bewohnern macht nicht nur der mangelnde Platz und die Massen der Flüchtenden zu schaffen. Auch gewaltbereite Rechtsextreme werden von den Flüchtlingsmengen angezogen, die zu Gewalt an den Neuankömmlingen aufrufen, Randalen begehen und sich mit Linksextremisten auf offenen Strassen Schlachten liefern. Die Probleme auf Lesbos sind nicht neu, sondern beschäftigen die Einwohnerschaft, die Regierung Griechenlands und der EU schon seit Monaten.
Ein letzter Kampf gegen das syrische Regime
Der Konflikt in Syrien ist kompliziert und die verschiedenen kriegführenden Parteien eng mit- und gegeneinander verstrickt (für mehr Informationen zum syrischen Bürgerkrieg, hier klicken). Zu Beginn dieses Monats startete die Türkei einen erneuten Angriff gegen regierungstreue, syrische Truppen, was eine Welle von flüchtenden Menschen auslöste. Bei der nordsyrischen Stadt Idlib, auf die sich der Krieg nun verschoben hat, handelt es sich um die letzte Rebellenhochburg, die noch nicht vom Assad-Regime kontrolliert wird. Laut der Tagesschau.de sind im Februar rund 900’`000 Menschen aus der Stadt geflohen. Vorerst hatte die Reise der schutzsuchenden Massen bereits an der Grenze zur Türkei ein Ende gefunden. Vor kurzem hat Erdogan die Grenze geöffnet und so die Durchreise bis nach Griechenland ermöglicht. Doch woher kam dieser plötzliche Entscheid des türkischen Präsidenten?
Menschenmassen als politisches Druckmittel
Wie die Tagesschau berichtet, signalisiert Erdogan mit der Grenzöffnung ein klares Zeichen in Richtung des Westens. Hunderttausende Flüchtlinge hätten zuvor an der nordsyrischen Grenze ausgeharrt – dies unter miserablen Bedingungen. Um die von der türkischen Regierung angeforderte Hilfeleistung für die Flüchtlingsmassen, sowie Militärunterstützung im Syrienkrieg zu erhalten, habe Erdogan eine schon monatealte Drohung wahr gemacht. Türkei-Sprecher Ibrahim Kalim weist dies aber zurück. «Wir haben nicht vor, dadurch eine künstliche Krise heraufzubeschwören und politischen Druck auszuüben. Für uns waren die Flüchtlinge noch nie Gegenstand politischer Erpressung. Die Türkei hat sich bemüht, die Flüchtlingsströme in die Europäische Union aufzuhalten. Aber die Kapazitäten der Türkei sind jetzt ausgeschöpft. Je schneller die EU und alle Betroffenen handeln, desto schneller kann diese Krise gelöst werden», so Kalim.
Ein Schachmatt für den Westen?
Jetzt stossen die Kapazitäten des griechischen Grenzschutzes an ihr Limit. Wie die Zeit online berichtet, verwenden die Behörden Griechenlands bereits Tränengas und Wasserwerfer, um die Massen an ihrer Einreise zu hindern. Ständige Zusammenstösse zwischen der Grenzpolizei und den Flüchtenden sind an der Tagesordnung. Griechenland, wie auch die EU, befindet sich nun in einer Pattsituation. Eine Weiterschleusung und Verteilung der Flüchtlinge scheint für die europäischen Staaten aufgrund der grossen Mengen nahezu unmöglich, gerade mit den neuen Herausforderungen, die das Coronavirus mit sich bringt. Bleiben die flüchtenden Menschen aber an Ort und Stelle, wie in den Auffanglagern auf Lesbos, so ist nicht nur die Versorgung, sondern auch das friedliche Zusammenleben an den Knotenpunkten der Menschenströmungen gefährdet. Vor etwa einer Woche brannte ein Haus der schweizerischen Hilfsorganisation «One happy Family» nieder, verletzt wurde dabei niemand. Spekulationen ergeben, dass es sich dabei um einen Gewaltakt von Rechtsextremen gehandelt haben musste. Sicher ist man sich dabei aber nicht. Auch eine Erstaufnahmestelle der UNO litt an einem Brandanschlag, der vor wenigen Wochen verübt worden war.