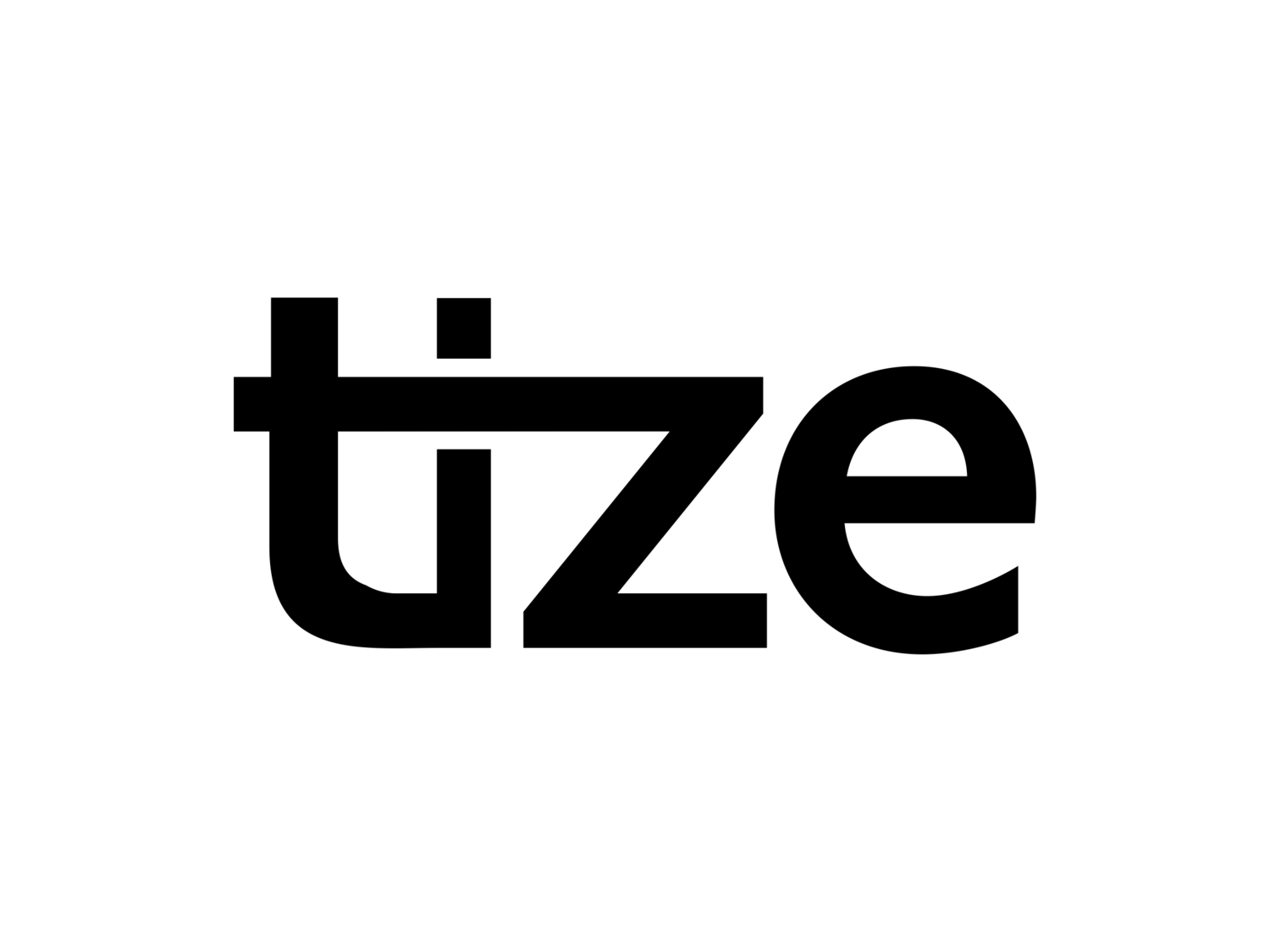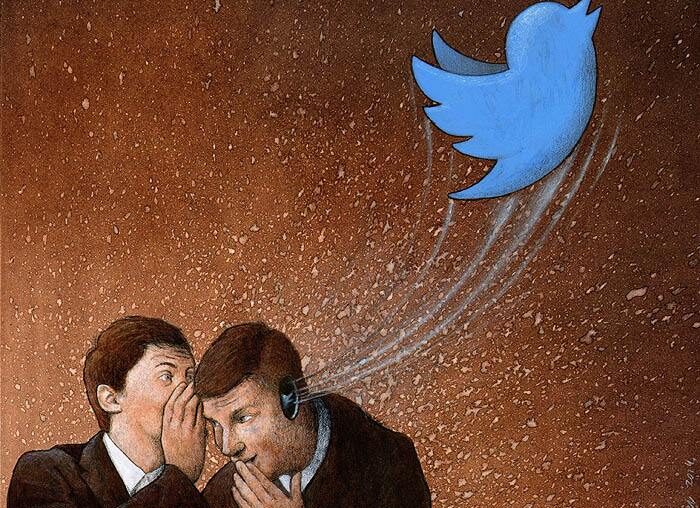Sexueller Missbrauch ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Häufig werden Opfer ignoriert, beschuldigt oder verhöhnt. Sexuelle Gewalt wird oft verharmlost und in Unterhaltungsmedien in einem falschen Licht dargestellt. Das Kultivieren falscher Stereotypen schadet der Gesellschaft, viele dieser Stereotypen handeln über den Mann.
Morde, Vergewaltigungen, Raubüberfälle… Immer wieder hört man in den Medien von den Schandtaten des Menschen. Zeitungen, Dokumentarfilme und die Tagesschau berichten kaum von einem Erfolg, einer Heldentat. Immer nur das Schlechte wird erwähnt. Auch in den Geschichtsbüchern liest man nur von Kriegen, Vernichtungslagern und Invasionen. Dass wir ein schlechtes Bild vom Menschen haben, ist also gar nicht verwunderlich. Schon seit Jahrhunderten prägt die westlichen Länder der Grundgedanke, dass der Mensch im Grunde schlecht sei. Menschen wie Machiavelli haben dieses Denken nur noch mehr gefestigt.
Doch was wäre, wenn der Mensch in Wahrheit nicht schlecht, sondern gut ist? Was, wenn wir grundsätzlich gut sind? Kaum vorstellbar – wie könnte man dann all diese miserablen Taten wie den Holocaust rechtfertigen? Sind denn nicht wir Menschen ganz klar Schuld daran?
Rutger Bregman scheut sich in seinem Werk nicht vor solch schweren Fragen – denn er ist sich sicher, dass wir Menschen eigentlich gar nicht so schlecht sind, wie es stets behauptet wird. Der Fehler, der Grund für all das Schreckliche, liegt nicht direkt in unserer Natur – der wahre Feind sind der Grundbesitz und die Gesellschaft.
Vor Äonen lebten wir Menschen nämlich noch in Frieden miteinander, doch erst als der ersten einen Zaun um ein Gebiet herum anlegte und sagte «das ist Mein», begannen die Auseinandersetzungen. Erst ab jenem Moment begann die dunkle Zeit des Menschen, denn vorher kam man auch gar nicht auf die Idee, etwas seinen Besitz zu nennen. Alles gehörte jedem und jeder.
Auch das stets negative Gedankenbild, das uns in den Medien entgegenschlägt, ist nicht gerade hilfreich. Wenn wir stets nur das Schlechte im Menschen sehen und von ihm nur Schlechtes erwarten, werden wir höchstwahrscheinlich auch nichts Gutes bekommen. Denn immer wieder sehen wir: Vertraut man einem Menschen, so werden seine Taten mit grosser Wahrscheinlichkeit auch zufriedenstellender sein.
Doch das ist noch lange nicht alles, was den Menschen schlecht dastehen lässt. Vorurteile, Distanz, Misstrauen, Egoismus, … Es gibt so viele Faktoren, die uns Menschen beeinflussen.
Und dennoch – schlussendlich sind wir alle gut. Davon ist Bregman mit Herzen überzeugt. Und er überzeugt auch all seine Leser mit erstaunlichen und herzerwärmenden Geschichten. Geschichten, die wie weltfremde Utopien und Fantasiewelten erscheinen, aber wirklich wahr sind.
Feindliche Truppen, die während dem Krieg zusammen Weihnachten feiern; Wächter, die mit den Verbrechern angeln; Schulen ohne Leistungsdruck, in denen jeder seine Träume verwirklichen kann. Rutger Bregman betrachtet die Geschichte aus einem völlig neuen Licht – schnell wird man merken, dass die Geschichte nicht so schwarz ist, wie man immer dachte.
Lassen Sie sich verzaubern von Bregmans Welt, unserer Welt. Was wie ein wundervoller Traum erscheint, ist die Realität – nur waren wir uns nie dessen bewusst. Wer dieses Buch liest, dem wird die Welt danach viel positiver erscheinen.
Die exponentiell angestiegenen Corona-Fallzahlen machen sich auch am sonst florierenden «Place to be» der Solothurner*innen bemerkbar. Statt dem schallenden Gelächter spätabends am «Aaremürli», stösst man auf gähnende Leere. Was bedeutet das für die Gastronomie? Tize fragt nach, mit welchen Folgen die Solothurner Bevölkerung zurzeit rechnet.
Der Schrei nach Gleichberechtigung wird in der Welt immer lauter. Frauen formieren Bewegungen, kämpfen um ihre Rechte und stehen für ihr Geschlecht ein, sei es in der Politik oder im Kampf gegen den Sexismus. An vielen Orten mit Erfolg: Die Stimme der Frau wird gehört, der Frauenstreik im letzten Jahr ging als die «grösste politische Aktion seit dem Generalstreik von 1918» in die Schweizerische Geschichte ein. Doch um mehr als nur gehört zu werden, muss ein Ruck durch unsere Gesellschaft gehen – und dabei darf eines nicht vergessen werden: Der Mann.
Wir Menschen lachen gerne, vielmals über Witze, die in «schwarzen» Pointen enden. So ist es auch bei der Satire, die vom öffentlich-rechtlichen Programmangebot kaum wegzudenken ist. Doch was ist politisch und moralisch vertretbar und wo liegt die Grauzone? Von schwarzen Witzen in der Medienwelt und wann ein Eingriff in die Pressefreiheit nötig ist, ein Kommentar.
Gerade in Zeiten von COVID-19 kommt vermehrt die Frage auf: Über was darf ich noch lachen? Welche Witze sind legitim und ist Satire überhaupt noch angebracht? Die gleiche Frage stellt man sich in der Medienwelt. Das Coronavirus belegt Zeitungen, prägt ganze Stories in Fachzeitschriften und flimmert auch im Fernsehen durch Nachrichtensendungen, Talkshows, etc. hindurch. Kurz gesagt: Dieses Virus hat uns fest im Griff und ist Gesprächsthema Nummer eins. Für Satiresendungen, wie beispielsweise die «ZDF-heute Show», führt kein Weg an Corona vorbei, obschon es sich bei diesem Virus um eine sehr ernste und heikle Angelegenheit handelt. Doch sie scheinen sich zu helfen wissen, die «Satirekönige».
Provozieren in voller Härte
Die «ZDF-heute Show», moderiert von Oliver Welke, behandelt das Coronathema massenhaft. Eine Show, welche sich im letzten Jahr auch schon mit der deutschen Polizei in Heilbronn angelegt oder laut dem Onlinemagazin Watson Passanten «blossgestellt» habe. Im Vergleich zu Jan Böhmermann, der im Jahre 2016 ein Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten veröffentlichte und somit ein internationaler Skandal losgetreten wurde, noch heilig. Aber ist die Satire nicht da, um zu provozieren? Einem Bericht der NDR-Satiresendung «Extra 3» ist zu entnehmen: Ja, Satire ist effektiv dazu da, um zu provozieren und das in voller Härte.

Die Satire als «Kronjuwel» des freien Journalismus?
Trotzdem ist es schwierig einen Überblick über die Grauzone zu haben. Welcher Witz gebracht wird, welche Passage in eine Sendung eingebaut wird, ist immer situationsabhängig. So gibt es laut Extra 3 bei einer Satiresendung immer einen sogenannten «Feind», der genaustens analysiert und Stück für Stück auseinandergenommen wird. In deutschen Sendungen ist es häufig die AfD, allen voran Björn Höcke, die in Satiresendungen unter Beschuss kommt. Generell neigen Politikerinnen und Politiker besonders gut dazu, Ziele für kabarettistische Attacken zu werden.
Wie der Journalist Kurt Tucholsky sagte: «Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist: Er will die Welt guthaben, sie ist schlecht, und nun rennt er gegen das Schlechte an.» Damit gemeint ist das Aufgreifen von Themen, die in den Augen des Satirikers faktisch falsch sind und mit einem humoristischen Angriff klargestellt werden – und das mit einem Hürdenlauf, in dem es über jegliche Tabus zu springen gilt, was eine Meisteraufgabe im Journalismus darstellt. Hinter der Satire steckt also eine Menge an Recherchearbeit, die gepaart mit einer klar ausgerichteten Meinung der Sendung, eingebauten Witzen und Sprüchen zum Endresultat führt: Ein lachendes Publikum, das neben der Unterhaltung gleichzeitig auch noch informiert wird. Man könnte somit behaupten, dass die Satire als «Kornjuwel» des freien Journalismus gilt.
«Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist: Er will die Welt guthaben, sie ist schlecht, und nun rennt er gegen das Schlechte an.»
Kurt Tucholsky, Journalist (1890-1935)
Schwarzer Humor in Zeiten der Corona-Krise
Freier Journalismus hin oder her, ethische und moralische Grundsätze müssen dennoch eingehalten werden. Fakt ist, dass Humor allen Menschen in Zeiten von COVID-19 guttut. Weshalb nicht über die Situation lachen? Das nimmt sich die «ZDF-heute Show» zum Ziel. So redet Oliver Welke in der Sendung vom letzten Samstag zum Beispiel über Homeschooling, Abitur und deutschen Föderalismus. Trotz fehlendem Publikum im Studio aufgrund der Kontaktsperre, wird das Ziel erreicht: Die Zuschauer zuhause am Bildschirm sind unterhalten und werden dazu ermuntert, ihr Lachen nicht zu verlieren. Solange die Infizierten- und Streberate des Virus und die prekäre Gesundheits- und Wirtschaftslage nicht heruntergespielt werden, stellt sich die Frage: Warum nicht?
Jede fünfte Person ist Statistiken zufolge davon betroffen und dennoch hört man kaum davon: SPS (kurz für Sensory Processing Sensitivity) steht für eine erhöhte sensorische und emotionale Wahrnehmung in der Psyche eines Menschen. Auch der 21-jährige Elia Catena ist von diesem Phänomen betroffen und erklärt, was Hochsensibilität genau ist und wie ein junger Mann im 21. Jahrhundert damit umgeht. Hochsensibilität auf den Punkt gebracht – diesen Monat bei Tize klärt auf.
«Interessant ist, dass sehr viele Menschen hochsensibel sind, davon aber keine Ahnung haben.» Der in Solothurn lebende Elia Catena ist hochsensibel und geht offen damit um. Begeistert, von diesem psychologischen Phänomen erzählen zu können, erklärt er, was genau im Innern eines Hochsensiblen vor sich geht. Neurologen gehen davon aus, dass Menschen mit einer hochsensiblen Veranlagung eine erhöhte neurologische Aktivität im Bereich der Sinneswahrnehmung aufweisen, wie Elia erklärt. Er selbst arbeitete bis letzten Dezember in einer Institution für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, wo er auch seine Ausbildung abschloss. «Ich habe mich schon immer sehr für das Selbst des Menschen interessiert und habe damit begonnen, mich neben der Arbeit mit mir selbst auseinanderzusetzen, was wirklich bereichernd war.»
«Interessant ist, dass sehr viele Menschen hochsensibel sind, davon aber keine Ahnung haben.»
Elia, was genau bedeutet es für dich, hochsensibel zu sein?
«Mit der Hochsensibilität konnte ich mich und meine Persönlichkeit besser einordnen. Ich habe nun einen Identifikator, was mir etwas Erleichterung im Auf und Ab des Lebens bietet, kann mich ein Stück weit damit identifizieren und fand somit ein weiteres Puzzleteil meines Ichs.» Er habe schon in der Pubertät gemerkt, dass bei ihm etwas anders ist als bei den meisten anderen. «Ich bin ein Mensch, der erst sehr spät wusste, was aus mir werden sollte und so ganz habe ich diesen Prozess auch noch nicht abgeschlossen. Aber mit der Eigendiagnose der Hochsensibilität hat für mich plötzlich alles Sinn ergeben. Es fühlt sich an, als hätte ein weiteres Puzzleteil zur Vervollständigung meines Selbst gefunden, das gibt mir auch einen gewissen Halt.»
Elia erklärt, wie er die verschiedensten alltäglichen Situationen wahrnimmt: «Hochsensibilität zeigt sich auf unzählig verschiedene Arten. Es ist sehr schwer Hochsensibilität zu verallgemeinern, vor allem aufgrund der menschlichen Diversität. Ich nehme emotionale Sinneseindrücke sehr intensiv wahr. Zum Beispiel spiegle ich die Gefühlszustände von anderen Personen wider und fühle diese gleichzeitig sehr stark. Wissenschaftler haben erwiesen, dass für das Widerspiegeln von Gefühlszuständen die sogenannten «Spiegelneuronen» verantwortlich sind, diese sind auch für das Empathievermögen zuständig. Das kann manchmal schon überfordernd sein, besonders wenn ich von mehreren Menschen umgeben bin, die mir nahestehen. Da fällt es mir leichter, Gefühle nachzuempfinden. Es ist aber auch ein Vorteil, denn ich kann dadurch Menschen in schwierigen Lebenssituationen besser beistehen, weil sie sich von mir Verstanden fühlen. Natürlich kann ich auch Glücksmomente nachfühlen, was sehr schön ist.»
Welche Arten von Hochsensibilität gibt es?
Wie Elia sagt, wird zwischen drei verschiedenen Arten der Hochsensibilität unterschieden. «Da wäre der sensorisch sensible Mensch, der emotional Sensible (der vor allem auf Gefühlszustände reagiert) und der kognitiv Sensible. Letzterer prägt ein hohes Verständnis für Logik und komplexere Zusammenhänge. Ich muss dazu sagen, dass eine hochsensible Person nicht nur eine dieser Arten aufweist, sondern mehrere einzelne Symptome gleichzeitig auftreten. Eine dieser Arten ist lediglich die Dominierende.» Bei ihm seien vor allem die Bereiche der Kinästhetik, des Geruchsinns und des Agierens innerhalb einer Gruppendynamik dominierender. «Schon nur wenn ich an einem gemütlichen Samstagabend in einer Gruppe unterwegs bin, laufen meine inneren Sensoren auf Hochtouren. Ich spüre bei allen Gruppenmitgliedern, wie diese sich fühlen und versuche das Geschehen so zu steuern, dass alle einigermassen zufrieden sind. Sind alle zufrieden, fühle auch ich mich wohler und kann mich der Gruppendynamik anschliessen.»
Wie hast du gemerkt, dass du hochsensibel sein könntest?
Schon im Kindesalter haben ihm seine Eltern und andere Mitmenschen gesagt, dass er ein sehr sensibles Kind sei. «Das war überhaupt nie abwertend gemeint. Die meisten waren sehr dankbar dafür und respektierten mich.» Doch Elia wollte sich zu diesem Zeitpunkt nicht mit sich selbst auseinandersetzen. «Es gab Phasen in der Pubertät, in denen ich mich selbst dafür verflucht habe und mich fragte, was denn nicht mit mir stimmte. Ich denke das geht zu Beginn vielen so.» Der eigentliche Auslöser war aber eine Freundin, die Elia im Laufe seines Lebens kennengelernt habe. «Diese Person ist mir sehr ans Herz gewachsen und hat mich von Anfang an unterstützt.» Sie hatte sich aus Interesse mit dem Thema auseinandergesetzt und mit Elia etliche Gespräche darüber geführt. «Zu meinem Geburtstag hat mir die genannte Freundin das Buch «Proud to be Sensibelchen» von Maria Anna Schwarzberg geschenkt. Ich konnte mich sofort mit beinahe allem identifizieren, was in diesem Buch geschrieben steht. Somit war für mich der Fall klar: Ich bin hochsensibel.»
«Somit war für mich der Fall klar: Ich bin hochsensibel.»
Wie würdest du das Gefühl beschreiben, das mit der Eigendiagnose in dir ausgelöst wurde?
«Es war nicht befreiend, eher öffnete es mir die Augen, wenn ich so an vergangene Geschehnisse und mein Leben im Allgemeinen zurückdenke. Wie schon erwähnt, fand ein weiteres «Puzzleteil», das brachte mir grosse Erleichterung. Gleichzeitig wurde ich so vor neue Herausforderungen gestellt und ich begann ich mich mehr mit mir auseinanderzusetzen.» Elia sei sehr dankbar für diese Erfahrung, wie er sagt. Um mehr über das Thema zu erfahren habe er sich anschliessend verschiedene Podcasts angehört und liess sich Konflikte mit seinen Freunden aus der Vergangenheit durch den Kopf gehen. «Es war sehr interessant, welchen neuen Blickwinkel ich plötzlich auf die verschiedensten Dinge hatte.»

Was sagt dein Umfeld dazu, wenn du erklärst, dass du hochsensibel bist?
Seiner Familie sei bereits klar gewesen, dass Elia hochsensibel sein könnte. «Ja klar, das wissen wir und weiter?», so hätten beispielsweise seine Eltern reagiert. «Viele aus meinem Umfeld, gerade enge Freunde, reagieren mit grossem Verständnis und sind so fasziniert davon, dass sie am liebsten alles darüber erfahren würden. Das erleichtert mich sehr und gerne füttere ich dieses Bedürfnis auch und berichte von meinen Erfahrungen.» Daneben gebe es auch solche, die mit Unverständnis reagieren. «Das ist für mich vollkommen in Ordnung, damit kann ich leben», versichert Elia.
In welchen Bereichen des alltäglichen Lebens schränkt dich deine Hochsensibilität ein?
«Grösstenteils werde ich nicht eingeschränkt. Die Hochsensibilität ist ein Teil von mir und ich muss mich arrangieren. Ich sehe es mehr als Möglichkeit. Trotzdem kann es gerade bei grösseren Gruppen, in denen ich mich bewege, vorkommen, dass ich mich plötzlich unwohl fühle und ich erst einmal herausfinden muss, welche Reize mich überfordern.» Das nützt Elia aus, um kurz den «Siedepunkt» zu verlassen, rauszugehen und sich zu sammeln. «Das schränkt mich schon ein, da ich halt die Gruppe für eine kurze Zeit zurücklassen muss», ergänzt er. «Ich kann dann auch ohne Problem sagen, dass es mir zu viel wurde. Ich finde, dass sollte jeder Mensch machen und sagen dürfen, ob hochsensibel oder nicht.»
Kennst du Leute in deinem Umfeld die hochsensibel sind und wie gehst du mit denen um?
«Es gibt viele in meinem Freundeskreis, die entweder hochsensibel sind oder vereinzelte Symptome aufweisen. Mit der einen Freundin, die ebenfalls hochsensibel ist, spreche ich oft über das Thema. Generell pflege ich aber keinen speziellen Umgang mit den Leuten. Im Gegenzug erwarte ich auch nicht, dass mein Umfeld anders mit mir umgeht.» Elia sieht auch gewaltige Unterschiede, wenn er sich mit anderen Hochsensiblen vergleicht. «Das Spektrum der Hochsensibilität ist so riesig, dass es schwierig ist Differenzen zu Menschen mit gleicher oder ähnlicher Thematik zu erkennen. Spannender finde ich, Gemeinsamkeiten untereinander ausfindig zu machen. Der emotionale Sinn ist nach meinen Beobachtungen der, der bei den Leuten in meinem Umfeld am ausgeprägtesten ist.» Durch den regelmässigen Austausch könne man eine Reflexion provozieren. Diese Selbstreflexion sei im Umgang mit Hochsensibilität essenziel.
«Man ist ein gewöhnliches Individuum mit individuellen Charakterzügen.»
Hast du Ratschläge für Menschen, die bereits hochsensibel sind oder das Gefühl haben, sie könnten auch zu diesem Spektrum gehören?
«Tests dazu machen, das kann einem Sicherheit vermitteln. Mir persönlich hat das sehr geholfen.» Er rät den Betroffenen, sich selbst zu akzeptieren und sich ein wenig zu beobachten. «So kann eingeschätzt werden, in welchen Lebensbereichen die Hochsensibilität zutrifft, wo Unterstützung angefordert werden kann und wie am besten Selbsthilfe betrieben wird.» Massgebend sei, durch eine Eigendiagnose nicht in Hochmut oder im Gegenteil, Selbstmitleid zu verfallen. «Ein hochsensibler Mensch ist weder besser noch schlechter. Man ist ein gewöhnliches Individuum mit individuellen Charakterzügen», fügt Elia hinzu.
Wie findest du, wird mit dem Thema in der Öffentlichkeit und in der Politik umgegangen?
«Generell finde ich, wird Hochsensibilität zu wenig thematisiert. So müssen insbesondere die stärker betroffenen selbst damit umgehen und erst einmal selber auf die Diagnose kommen, statt Hilfe von aussen erwarten zu können. Das kann dann zum Problem werden, wenn sich Personen regelrecht fragen, was denn nicht mit ihnen stimme, so wie es bei mir in der Pubertät war.» Im Gleichzug findet Elia aber auch, dass es wichtigere Themen als die Hochsensibilität gibt. Dazu sagt er: «Hochsensible Menschen können nichtsdestotrotz ohne weitere Probleme ihr Leben bestreiten, es ist in diesem Fall keine Krankheit oder Behinderung, sondern eine etwas ausgeprägtere Eigenschaft.»
«Wer hochsensibel ist, hat keine extra Wurst!»
Was für Elia gar nicht geht ist, wenn Menschen ihre Hochsensibilität als Ausrede verwenden. «Es ist keine Ausrede für gar nichts und verpflichtet niemanden, dass er mit der betreffenden Person anders umgeht. Wer hochsensibel ist, hat keine extra Wurst!» Trotzdem sei es wichtig, dem Thema offen zu begegnen. «Wenn ich aber jemandem erzähle, dass ich hochsensibel bin und dabei auf Desinteresse stosse, sollte mir das als Betroffener nichts ausmachen. Gegenseitiger Respekt ist wie bei so vielem, das A und O.»
Willst du zum Schluss den Leserinnen und Lesern von Tize etwas auf den Weg geben?
«Diejenigen die mich kennen, lade ich herzlich dazu ein, mich bei weiteren allfälligen Fragen zu löchern. Ich gebe sehr gerne Auskunft, wie Tipps und Tricks zum Thema.» Auch an die Leserschaft, die sich mit der Hochsensibilität identifizieren kann, hat Elia eine Botschaft: «Macht euch nicht selbst fertig, akzeptiert eure Persönlichkeit und seid offen. Es ist ein spannendes Thema und es lohnt sich, sich damit zu befassen.
Wir danken Elia für das interessante Gespräch.
Die Reihe «Tize klärt auf»: Jeden letzten Montag im Monat erscheint auf Tize ein neuer Bericht über brandaktuelle, häufig diskutierte und spektakuläre Themen in allen möglichen Bereichen, dargestellt mit Analysen, Aufzeichnungen oder Interviews – von der jungen, für die junge Generation.
Hier geht’s zur ganzen Reihe: Tize klärt auf
Ob in den USA, Italien, Deutschland, Brasilien oder Indien: Rechts- und linkspopulistische Politiker gewinnen immer grösseren Zuspruch. In manchen Ländern gewinnen sie Präsidentschaftswahlen, anderen Ortes stellen Aussen-Parteien «nur» eine Minderheit als Randpartei. Wieso unsere Gesellschaft zurzeit einen derartigen Aufschwung der polarisierenden Flügel erlebt und was die Folgen davon sein können, jetzt bei «Tize klärt auf».
Sie nennen sich «Patrioten», «Retter der Nation» oder auf der anderen Seite «Antifaschistisch» und «Die Linke»: Politisch aussenstehende Gruppierungen oder Parteien finden vor allem in Europa immer grösseren Aufwind, wie eine Studie zeigt. Auch die neusten Ereignisse in der in Thüringen anhaltende Regierungskrise lässt die Frage aufkommen, wie die Politik in der heutigen Zeit mit extremistisch Eingestellten umgehen sollte. Ausgelöst wurde die Krise durch die Wahl vom FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten. Dieser bekam bei der Wahl auch Stimmen der rechtsradikalen AfD (Alternative für Deutschland), was in der Geschichte der Bundesrepublik eine Sensation darstellt. Laut dem MDR wurde Kemmerich durch ein taktisches Manöver der AfD gewählt, welche mit allen Mitteln eine rot-grüne oder rot-rot-grüne Regierungskonstellation verhindern wollte. Mittlerweile haben sich die SPD und die CDU dazu verweigert, mit Kemmerich Politik zu machen und fordern eine «Korrektur der abgekarteten Wahl». Durch die Regierungskrise besteht nun eine grössere Möglichkeit der AfD, Stimmen für sich zu gewinnen. Der rassistisch motivierte Terroranschlag vom Februar 2020 in Hanau, bei dem neun aus dem Ausland stammende Menschen umgekommen sind, lässt den Unmut der Bevölkerung gegenüber der politischen Ohnmacht in Deutschland weiter hochkochen.
Rechtspopulismus als Beispiel: Rechts ist nicht gleich rechts
Das Spektrum der radikalen Rechtsparteien ist breit. Es ist nicht möglich, Donald Trump in den USA mit Matteo Salvini in Italien, Björn Höcke aus der AfD, dem Präsidenten der Türkei Recep Tayyip Erdogan oder dem Brasilianer Jair Bolsonaro zu vergleichen. Nicht alle Parteien und Politiker gehen gleichermassen radikal und offensichtlich «rechts» vor. Nur zwei Dinge haben rechte Politiker gemeinsam: Ihre politische Orientierung und die Tendenz, populistisch Politik zu machen. Bei der Präsidentschaftswahl im Jahre 2016 hatte vorerst noch niemand wirklich geglaubt, dass Donald Trump das Rennen gegen Clinton tatsächlich gewinnen würde. So ähnlich war es beim 2018 neu gewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Das Amt einem Politiker als Staatsführer zu überlassen, der weibliche Abgeordnete als «nicht Wert von mir vergewaltigt zu werden» bezeichnet (so berichtet die Zeit), scheint in der Schweiz und in Europa als gar unmöglich. Während Trump und Bolsonaro durch ihre lauten und eher unbedachten Worte auffallen, verhaltet sich beispielsweise der Bundeskanzler von Österreich Sebastian Kurz zurückhaltend. Durch seine gut überdachten Worte, der ausgeschmückten Sprache und der Nähe zum Volk, wirkt er auf viele Österreicherinnen und Österreicher als Hoffnungsträger. Auch der Lebenslauf von Kurz scheint nahezu wie aus dem Bilderbuch zu stammen. 2004 legte er die Matura mit Auszeichnung ab, dann studierte er Rechtswissenschaft und ist schon seit 2003 Mitglied der JVP (Junge Volkspartei). Nach die Freiheitsliebe steht fest, dass die österreichische Regierung zum Zweck der Zentrumsbildung mit einer rechtsradikalen Partei, der FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs), paktiert. Auch der türkische Präsident Erdogan habe für Wahlen im Jahre 2018 eine «Volksallianz» mit der faschistischen MHP-Partei geformt. Die sogenannten «grauen Wölfe» gehen vor allem gewaltsam gegen die kurische Minderheit in der Türkei vor.
Gründe für den Aufschwung des Populismus
Kriege wie in Syrien und Afghanistan oder Armut in Regionen wie Mexiko, Südamerika, etc. sind Auslöser von unzähligen Flüchtlingsströmen, die zu uns in den Westen führen. Nach Mediendienst Integration sind allein aus Syrien 770`000 Menschen allein nach Deutschland geflohen (Stand 2018). Bei vielen Europäerinnen und Europäern trifft das Thema Migration auf einen wunden Punkt, kein anderes Thema wird in der Gesellschaft stärker debattiert und bis aufs letzte ausgeschlachtet. Nicht zuletzt auch in der Schweiz, gerade durch die SVP, die bei Abstimmungen mit ihren Plakaten am Wegesrand jeder Passantin und jedem Passanten ins Auge sticht. Der Ursprung der Urangst gegenüber Migration scheint wohl gerade für einen liberalen und zeitgeistlichen Menschen schwer nachzuverfolgen, vor allem zu verstehen. Viele fürchten sich vor dem Verlust von Arbeitsplätzen oder im Allgemeinen, im eigenen Land zu kurz zu kommen, sei es in Bereichen der staatlichen Sozialleistungen, bei der Wohnungssuche, etc.
Populismus (gleichgültig ob im rechten oder linken Flügel) steht dafür, Themen volksnahe und demagogisch darzustellen und Sachverhalte über zu dramatisieren. Populistische Politiker beleuchten ein kompliziertes Thema gegenüber den eigentlich komplizierten Themen vereinfacht und stellen sich selbst so dar, als hätten sie die Lösung für alles. Hier kann man sich fragen: Wie funktioniert das so erfolgreich? Weil es einfacher ist einer pompös aufgemachten Parole zu folgen, statt selbst zu recherchieren und nachzufragen, bevor eine eigene Meinung gebildet wird. Die schnellen Umbrüche in der Medienbranche durch Social Media und die Verlagerung der News und der Politik ins Internet stellen weitere Möglichkeiten dar, Populismus zu fördern. Ein Beispiel wäre der Instagram-Account von Donald Trump oder seines Sohnes Donald John Trump. Letzterer bezeichnet sich selbst als «General der Memes», die vor allem gegen die amerikanische demokratische Partei ausgerichtet sind. Das gleiche passiert auf der linken Seite. Diverse «Meme-Pages» auf Instagram und anderen Social Media Kanälen, wie beispielsweise der von sich selbst ernannte Internet-Guerilla «dreckiger Kommunist», greifen tagtäglich brisante Themen auf und stellen diese mit Karikaturen da, um Stimmung gegen eine Partei, einen Politiker, etc. zu machen. Dabei werden Symbole, wie der Hammer und die Sichel, unter denen in Zeiten der UdSSR Millionen Menschen ums Leben kamen, verherrlicht.
Weshalb stellt Populismus ein grosses Problem dar?
Eine gut funktionierende Demokratie braucht für den politischen Diskurs linke, mittige, wie bürgerlich rechte Parteien und Politiker. Es braucht einen Ausgleich zwischen den Fronten, damit keine Ein-Parteien-Politik entsteht, wie es in Russland, China oder bald vielleicht auch in den USA der Fall ist. Wichtig ist aber, dass in jedem Flügel Themen sachlich ausdebattiert werden und dass Parteien, die Beziehungen zum faschistischen oder radikal kommunistischen Untergrund pflegen, mit Sanktionen bestraft werden.
Rechtspopulismus beispielsweise fördert also nicht nur den Hass der einheimischen Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen und Migranten, sondern bringt auch die Grundordnung der Demokratie in Gefahr. Faschisten und Linksradikale, die wie oben aufgezeigt, vielmals mit extrem rechten und linken Politikern zusammenarbeiten, streben einen totalitären Staat an, der mit eiserner Hand durch Diktatur geführt wird und gegen jeden vorgeht, der «aus der Reihe tanzt» und eine andere Meinung vertritt.
Die Reihe «Tize klärt auf»: Jeden letzten Montag im Monat erscheint auf Tize ein neuer Bericht über brandaktuelle, häufig diskutierte und spektakuläre Themen in allen möglichen Bereichen, dargestellt mit Analysen, Aufzeichnungen oder Interviews – von der jungen, für die junge Generation.
Hier geht’s zum letzten Beitrag der Reihe:
Tize klärt auf – Warum sich die Zwischenfälle im Persischen Golf häufen
Das Schweizer Militär gerät des Öfteren in Kritik. Es koste zu viel, wäre unnötig und überhaupt: Die Schweiz wäre doch viel zu unwichtig, weshalb sollte ein so kleines Land angegriffen werden? All das sind Kritikpunkte, die in alltäglichen Diskussionen immer wieder auftauchen und auch während den diesjährigen Wahlen, gerieten die «grünen Ferien» desöfteren in Beschuss. Wie wichtig ist eine Armee für ein kleines Land wie die Schweiz und welchen Stellenwert hatte sie in der Vergangenheit?
Vom Kindergarten, hinein in die Primarschule. Anschliessend ein guter Sek Abschluss mit darauffolgender Berufslehre oder gar ein Abschluss am Gymnasium. Grundsätzlich gilt, wer besser in der Schule ist, hat die besseren Chancen auf einen Karriereaufstieg. Doch ist ein solches System noch mit unserer Zeit zu vereinbaren?
3.4% beträgt die Arbeitslosenquote in der Schweiz nach dem Stand der offiziellen Seite des Bundes. Im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn, wie beispielsweise Deutschland mit seinen 5.6%, nach der deutschen Nachrichtenagentur die Zeit, oder Italien mit seinen 11.4%, nach Statista, geniesst die Schweiz einer der höheren Ränge. Der Grund dafür liegt bestimmt nicht zuletzt in unserem Bildungssystem. Doch in den vergangenen Jahren wurden die kritischen Stimmen immer lauter.
Die Schule als Wegbereiter in die Zukunft
Bildung ist wichtig, das ist uns wohl allen klar. Ohne Bildung gäbe es kein Wissen über die wichtigsten Erkenntnisse der Natur, der Wissenschaft, der Kommunikation oder der Regeln und Gesetze unserer Gesellschaft. Durch das Erlangen von Wissen können wir Menschen urteilen, Dinge erschaffen und ein Staat, ein Kontinent oder gar die ganze Welt in Bewegung bringen, immer wieder Neues erfinden oder entdecken und schlussendlich, neue Bildung einbeziehen. Bildung ist eines der wichtigsten Elemente einer gut funktionierenden Demokratie. In der Schweiz bekommt jedes Kind die Gelegenheit in die Schule gehen zu können.
Natürlich könnte jetzt die Frage aufkommen, weshalb denn das schweizerische Bildungssystem überhaupt in Kritik gerät. Doch wie werden die Talente und die Fertigkeiten des Einzelnen gefördert? Kann schlussendlich jeder Mensch seine Träume erfüllen und das machen, was zu ihm passt, was sozusagen für ihn bestimmt ist?
Uneinigkeiten zwischen Schulen und Arbeitgeber
Die Bildung gilt in der Schweiz als allgemeines Grundrecht. Ausserdem ist in der Bundesverfassung unter dem Art. 3 der Bildung für einen ganzheitlichen Menschen, der Erwerb von grundlegendem Wissen und Kenntnissen verankert, nach der Delegiertenversammlung des EDK. Hingegen ist aber unter demselben Artikel festgehalten, dass die Schüler von der Schule dabei unterstützt werden, individuelle Fähigkeiten zu entwickeln. Unter anderem wird in einem Artikel des Freiburger Arbeitgeberverbandes das Bildungssystem kritisiert, es würde zu wenig auf die Bedürfnisse der Firmen und der einzelnen Personen eingegangen. Auch hätten die einzelnen Firmen immer mehr Mühe, passende Kandidaten für eine freie Stelle zu finden, erstens, weil oft die Voraussetzungen nicht mit den Leistungen der BewerberInnen übereinstimmen und zweitens, dass sich immer weniger Schulabgänger für eine Lehrstelle bewerben.
Der «Gymnasiums-Boom»
Die gymnasiale Maturitätsquote befindet sich nach der Aargauer Zeitung aus dem letzten Jahre bei rund 20.1%. Das ist knapp über einem Fünftel aller Bildungsabschlüsse der Schweiz. Einer der Hauptgründe, weshalb immer wie mehr Jugendliche diesen Weg einschlagen, ist die Unsicherheit der Berufswahl. Es gibt viele Jugendliche, die sagen «Ich mache erst mal das Gymnasium, mal sehen, was dann passiert.» Also sind sich manche gar nicht wirklich sicher, welchen Beruf sie später einmal erlernen wollen oder machen sich vielleicht nicht einmal richtig Gedanken und absolvieren einfach die obligatorischen Schnuppertage, weil sie dies halt tun müssen. Wichtig zu erwähnen ist, dass es selbstverständlich auch Gymnasiums Schüler gibt, die genau wissen, wohin ihr beruflicher Werdegang sie treiben soll und sich auch dessen bewusst sind, was sie machen. Nichtsdestotrotz: Sollte die Findung der eigenen Identität und eines geeigneten Berufes jedes einzelnen Kindes nicht die Aufgabe der Schule sein, wie es auch in der Bundesverfassung festgehalten ist?
Die Wichtigkeit des Individualismus
Alle Fächer in der Schule sind wichtig, von der Mathematik, über die Sprachen, bis hin zur Geschichte und der Biologie. Doch wie sieht es mit den Menschen aus, denen ein bestimmtes Fach einfach nicht liegt? Das kann es durchaus geben und kommt auch vor. Wir Menschen ticken nicht alle gleich. Jeder von uns hat andere Interessen, andere Fähigkeiten und ist in allen Bereichen unterschiedlich gut. Das ist auch gut so. Eine Welt, in der alle gleich sind, dieselben Interessen haben und in allem gleich gut sind wie alle anderen, kann man sich kaum vorstellen. Ein Beispiel dafür wäre die Mathematik.
Die Mathematik zählt als einziges Fach an den schweizerischen Schulen doppelt. Heisst also, wer gut in diesem Fach ist, kann sich umso mehr über eine noch bessere Note freuen und möglicherweise sogar eine ungenügende Note in einem Fach ausbessern. Währenddessen versucht ein anderer Schüler, welcher in der Mathematik schwächere Leistungen erbringt, verzweifelt seine Durchschnittsnote mit den anderen Fächern, die aber nur einmal zählen, hochzubringen. Dies kann je nach SchülerIn grossen Stress bereits in der Sekundarstufe hervorrufen. Ausserdem kann es sein, dass wegen dieser höheren Gewichtung, die Schüler den gewünschten Ausbildungsweg nicht durchführen können, weil sie schlicht und einfach zu schlecht in einem Fach sind, welches doppelt gewichtet wird aber je nach gewünschtem Werdegang eines Schülers, nur halb so ausschlaggebend ist. So steht es in einem Interview der Berner Zeitung mit dem Mathematikprofessor Norbert Hungerbühler.
Nach langer Recherche nach der Antwort auf die Frage, weshalb ein gewöhnliches Fach wie die Mathematik nicht genau gleich gewichtet werden sollte, wie die anderen Fächer, wurde keine plausible Antwort gefunden.
Das finnische Bildungssystem als Vorbild?
Wie aber kann es möglich sein, den Leistungsdruck, der bei Schwierigkeiten in Fächern entstehen, die einem schwerfallen, zu minimieren? In Finnland beispielsweise, wird die Leistung nicht zu sehr nach den Noten bewertet. Erst ab dem 16 Lebensjahr werden dort Schulnoten eingeführt, was durchaus zu einer Verringerung des Stresses bereits im frühen Alter beitragen kann. Ausserdem sind die Schultage kürzer. Die Kinder in Finnland gehen morgens später zur Schule und gehen auch abends früher nachhause. Hingegen erhalten die Kinder aber mehr Hausaufgaben, die so in ihrem eigenen Tempo und ohne zusätzlichen Stress bewältigt werden können. Auch wird im finnischen Schulsystem kein Fach über ein anderes Fach gestellt. Jedes Fach soll gleich gewichtet sein und gleich wichtig zu sein, zu erlernen, wie es in einem Artikel von this is finland steht.
Nach der Botschaft von Finnland, belegte das Land im Jahre 2006 einer der höchsten Ränge in der PISA-Studie. Ob sich aber ein solches Bildungssystem positiv auf die Entwicklung der Wirtschaft eines Landes auswirkt, ist fraglich.